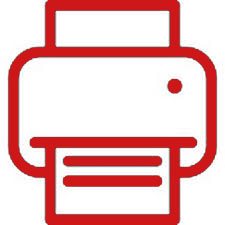Das Auftaktpanel, moderiert von Zoltán Tibor Pállinger, Professur für Politische Theorie und europäische Demokratieforschung an der AUB, beschäftigte sich mit den konzeptionellen Grundlagen der Demokratie. Der erste Referent der Konferenz, István Hegedüs von der Hungarian Europe Society, stellte dabei dar, wo Demokratie seiner Meinung nach bereits heute an ihre Grenzen stöße, beziehungsweise gefährdet sein könnte: in Ungarn. Hier regiere seit 2010 mit Viktor Orbán das selbsternannte „enfant terrible“ der EU. Laut Hegedüs habe Orbán mit einer Reihe von Gesetzen der Demokratie in Ungarn geschadet. Die aktuellen Entwicklungen mit Blick auf Griechenland, die Flüchtlingsfrage und den Krieg gegen den Terror würden ihm augenscheinlich Recht geben, seinen Kurs weiterzuverfolgen und mögliche Nachahmer inspirieren. Die Tendenz dabei sei klar: weg von einer liberalen Demokratie westeuropäischer Prägung hin zu einer wie auch immer gearteten illiberalen Demokratie, die Orbán 2014 in Tusnádfürdő (Băile Tușnad/Bad Tuschnad) auf einer Tagung ungarischer Intellektueller und Politiker bereits grob skizziert habe. Mangels Alternativen würden die meisten Wähler den populistischen Parolen und Umgestaltungsplänen Orbáns derzeit weitestgehend folgen, mit ungewissem Ausgang für Ungarn und die EU, wie Hegedüs betonte.
Mit neuen Formen populistischer Herausforderungen beschäftigte sich auch Anton Pelinka, Inhaber des Lehrstuhls für Politikwissenschaft und Nationalismusstudien an der Central European University in Budapest, in seinem anschließenden Vortrag. Zunächst sprach er von einem enormen Siegeszug der Demokratie als Staatsform auf dem europäischen Kontinent, aber auch in Asien, Lateinamerika und Afrika. Zahlreiche Krisen hätten aber gerade auch in den schon länger demokratischen Staaten in den vergangenen Jahren Schwächen offenbart, mit denen in dieser Form wohl niemand gerechnet habe. In Zeiten der Globalisierung, in der viele Entscheidungen transnational und weit entfernt vom Einfluss einzelner Wähler stattfinden, würden sich viele Bürger nach Vereinfachungen sehnen, einem neuen Wir-Gefühl, kurzum nach einer Inklusion in ein System, welches dann aber andererseits auch das vermeintlich andere exkludiere. Es steige auch die Sehnsucht nach einem klaren, nachvollziehbaren Kurs in unübersichtlichen Zeiten. Erfolge dieser nicht, entstehe eine zusehende Elitenverachtung, die letztlich im Ablehnen von Mehrheitsentscheidungen gipfelt, sofern diese nicht verständlich kommuniziert und transparent unter Beteiligung der Bürger erarbeitet würden. Dann würden Populisten mit reduktionistischen und vereinfachenden, aber umso stärker zugespitzten Entweder-oder-Botschaften ihren Nährboden finden, welcher ihnen nur sehr schlecht wieder entzogen werden könne, wie das Beispiel des Front National in Frankreich oder der FPÖ in Österreich zeige. Der Rechtspopulismus sei dabei im Wandel begriffen. Er lege den Antisemitismus zusehends ab und fokussiere sich auf den Islam als neue Bedrohung. Gerade im Bereich der gescheiterten Integration von Muslimen würden der politischen Mitte und insbesondere der Linken zusehends überzeugenden Argumente fehlen. Populismus könne daher durchaus eine Gefahr für die Demokratie sein, der man als Demokratie wiederum am besten mit klarer Kommunikation, starken und handlungsfähigen Institutionen und einem Ohr am Mund des Volkes entgegentreten müsse.
Die Frage nach dem Verhältnis von Bürgern, Institutionen und Demokratie im supranationalen Kontext stellte Ulrich Schlie, Professur für Diplomatie II an der AUB, in den Mittelpunkt seines Vortrages. Die Wähler seien Zeugen einer fortschreitenden Abgabe der Souveränität an supranationale Einheiten wie die EU. Gleichzeitig schlittere diese Institution derzeit aber von Krise zu Krise, wie Schlie betonte. Viele unbeantwortete Fragen wie z. B. nach der Legitimation der EU durch die EU-Bürger, der supranationalen Problemlösungskompetenz, der Relevanz der EU als außenpolitischer Akteur, usw. würden in vielen Staaten zu großem Verdruss und einer Erosion des Vertrauens der Bürger in die Lösungsfähigkeit supranationaler Organisationen, namentlich der EU, führen. Die EU müsse daher eine ehrliche Diskussion über ihre Zukunft führen und langfristige Strategien und Perspektiven aufzeigen, um die politische Steuerungsfähigkeit nicht zu verlieren.
Das Panel schloss mit einem Vortrag von Ellen Bos, Professur für Vergleichende Politikwissenschaft mit Schwerpunkt auf den Staaten Ost- und Mittelosteuropas in der EU an der AUB. Sie stellte dem Zustand der Demokratie ein gemischtes Zeugnis aus. Zwar seien 2011 45 Prozent der Staaten als liberale Demokratie zu klassifizieren und damit die Welt noch nie so demokratisch wie jetzt gewesen. Hinsichtlich der Definition, was genau eine Demokratie sei, ortete sie aber eine Orientierungslosigkeit und eine schier unübersichtliche Flut an neuen Begrifflichkeiten, die zu einem „konzeptionellen Babel“ führen würde. So gebe es zahlreiche Grauzonenregime und Autokratien, die zumindest manche Kennzeichen einer Demokratie erfüllen würden und trotzdem weit davon entfernt seien, als eine solche zu gelten. Hier würde dann beispielsweise von kompetitiven Autokratien, Fassadendemokratien und gelenkten Demokratien gesprochen. Begrifflichkeiten also, die auf demokratische Elemente schließen ließen und gleichzeitig deutlich machten, dass es hier nicht um Demokratie im westlichen Sinne ginge. Auch der Terminus eines hybriden Regimes verdeutliche, dass es zwischen einer Demokratie und einer Autokratie oft sehr viel Platz für Mischformen gebe. Bos plädierte daher für ein Mindestkonzept, welches Demokratien erfüllen sollten, um als solche zu gelten. Für sie gehörten vor allem die Möglichkeit zur sanktionsfreien, politischen Partizipation, freie, geheime und gleiche Wahlen, bei denen eine Regierung zumindest theoretisch auch abgewählt werden könne und eine funktionierende Zivilgesellschaft zu diesen Kriterien. Ohne ein Mindestmaß an Liberalismus in den oben erwähnten Bereichen könne ein Regime daher nicht als Demokratie bezeichnet werden.
Expertendiskussion zur Zukunft der Europäischen Demokratie
Der erste Konferenztag schloss mit einer Expertendiskussion zur Zukunft der europäischen Demokratie und ihren Bedrohungen von innen und außen. An dieser beteiligte sich neben Ellen Bos, Zoltán Pállinger und Ulrich Schlie auch Margareta Mommsen, emeritierte Professorin für Politikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Als Bedrohung von außen wurden dabei einhellig Putins Russland, der islamistischer Terror und der Aufstieg des Einparteienstaates China gesehen. Erfolge dieser Bedrohungen würden die EU auch von innen zusehends destabilisieren. Putins Einmischung in Georgien, der Ukraine und zuletzt die Intervention in Syrien hätten für Russland bisher kaum Konsequenzen gehabt. Gleiches gelte für religiös motivierten Terror. Daher sei es kaum zu vermeiden, wenn Staaten wie Ungarn und nun auch Polen die Systemfrage auch innerhalb der EU stellen würden. Beide Staaten seien zwar noch nicht in Richtung einer hybriden Oligarchie, wie Mommsen Russland klassifizierte, abgedriftet, das Konzept der illiberalen Demokratie sei aber eine klare Abgrenzung vom klassischen Demokratiebegriff, wie er in Westeuropa verstanden werde. Er umfasse aber einige Elemente des Putinismus wie der Stärkung der eigenen Position nach außen und der klaren, restriktiven Führung des Staates im Inneren. So gelte der Begriff Liberalismus in beiden Staaten mittlerweile als verpönter Kampfbegriff, mit dem politische Feinde diskreditiert werden können. Hinsichtlich der Bedrohung durch den Terrorismus war man sich einig, dass es keine hundertprozentige Sicherheit geben werde und Überreaktionen hinsichtlich einer Einschränkung von Bürgerechten und Freiheiten jetzt trotz der schrecklichen Anschläge von Paris tunlichst zu vermeiden seien, oder wie Pállinger zum Anschluss der Diskussion ganz bewusst in einem Werturteil anmerkte: „Freiheit muss in liberalen Demokratien immer Vorrang haben.“
Fallstudien: Europäische Demokratien im Vergleich
Den zweiten Tag der Konferenz und damit den Einstieg in die praktischen Fallbeispiele des zweiten, ebenfalls von Zoltán Pállinger moderierten Panels eröffnete Wichard Woyke, emeritierter Professor für Europapolitik an der Universität Münster, mit einem eindrucksvollen Bericht über den Zustand der Demokratie in Frankreich. Dort gebe es derzeit eine massive Identitätskrise in weiten Teilen der Gesellschaft, die das Verständnis von der Grande Nation untergraben würden. In diese Lücke wiederum könnten populistische Parteien wie der Front National oder die radikale Linke hineinstoßen und so salonfähig werden. Hinzu kommen eine chronische Wirtschaftskrise und enorme Probleme bei der Integration von Minderheiten, wie die Anschläge von Paris auf tragische Weise gezeigt hätten. Im Parlament seien ob des Wahlrechts aber nach wie vor fast nur die beiden Blöcke aus Bürgerlichen und Sozialisten vertreten. In den Departments, Kommunen und wohl ab Dezember auch den Regionen sehe das aber schon ganz anders aus, hier konnte wie auch bei den Europawahlen 2014 insbesondere der Front National im Norden des Landes, der Provence und in Lothringen große Gewinne erzielen. Woyke ortet daher ein Auseinanderdriften von parlamentarischer Repräsentation in Paris und öffentlichem Diskurs im Land, welcher zusehends radikaler zu werden scheine. Für die nächsten Präsidentschaftswahlen prognostiziert er wegen der konstant verheerenden Umfragewerte für den derzeitigen Amtsinhaber Hollande ein Duell Sarkozy – Le Pen, welches zu Gunsten des ehemaligen Präsidenten ausgehen dürfte. Dieser müsse sich allerdings zu gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen durchringen, um die Demokratie und die öffentliche Meinung langfristig zu stabilisieren, was kurz- und mittelfristig aber ob der zu erwartenden Widerstände von den beiden immer stärker werdenden Rändern des politischen Spektrums eine Herkulesaufgabe darstellen dürfte.
Auf den Lagebericht aus Frankreich folgte ein Sprung über den Ärmelkanal. Kálmán Pócza, Dozent für Politikwissenschaft an der Katholischen Péter-Pázmány-Universität in Budapest, untersuchte die Herausforderungen der Demokratie und den Stand der diesbezüglichen Reformen in Großbritannien. Er ortet einen bewussten Stillstand, der vor allem vom englischen Landesteil ausgehe, während Schottland und auch Wales demokratiepolitisch progressiver eingestellt seien. Für Schottland sei vor allem die Frage nach mehr Autonomie im Rahmen des von Tony Blair 1997/98 angestoßenen Devolutions-Prozesses oder nach einer vollkommenen Unabhängigkeit entscheidend. Weitestgehend Konsens bestehe hingegen in der Wahlrechtsfrage und der Bestimmung von Oberbürgermeistern außerhalb Londons, bei der sich in Befragungen jeweils klare Mehrheiten für die Beibehaltung des status quo ausgesprochen hätten. Kritisch merkte Pócza an, dass viele Reformen und Referenden, so auch das mit Spannung erwartet EU-Referendum, parteipolitisch genutzt würden und der Wille zu Reformen nach der Übernahme der Macht sowohl bei Labour als auch den Tories schnell erlahmen würde. Hinsichtlich der Partizipation sei anzumerken, dass diese sehr themenabhängig sei. So habe die Wahlbeteiligung bei der Unterhauswahl 1950, als Kriegspremier Winston Churchill nach einer chaotischen Labour-Regierung erneut die Mehrheit erringen konnte, bei ca. 80 Prozent gelegen, während sie bei Tony Blairs erster Wiederwahl 2001 mangels Alternativen auf etwa 60 Prozent abgestürzt sei. Seither stiege die Beteiligung aber wieder auf einen Wert etwas unterhalb des historisch gesehenen Mittelwertes von etwa 70 Prozent. Auch die Zufriedenheit mit Regierung, Parlament und Monarchie alterniere seit Jahren meist um einen bestimmten Wert, der temporär durch einzelne Krisen aber zum Teil deutlich nach unten verschoben worden sei. Eine systembedrohende Krise der Demokratie gebe es daher in Großbritannien nicht, wohl aber einen gewissen Reformstau, wie der Referent abschließend deutlich machte.
Dem Stand der Demokratie in den postkommunistischen Staaten widmete sich im Anschluss der an der TU Dresden lehrende Politikwissenschaftler Karel Vodička. Als dynamischen Faktor zur Etablierung von Demokratie machte er die Wirtschaft aus. Dort, wo sich ein gesellschaftlicher Mittelstand herausgebildet habe, beispielsweise in Tschechien oder den Baltischen Staaten, trage dieser zur Stabilisierung der Demokratie und zum langfristigen Bruch mit den alten Kadern des Kommunismus bei. Trotzdem werde hinsichtlich der Wahlbeteiligung sehr genau zwischen der Wichtigkeit der Wahlen unterschieden. So seien gerade die Tschechen und Slowaken bei Regional- aber auch EU-Wahlen mit teilweise einstelligen Partizipationsraten absolute Schlusslichter. Bei Parlamentswahlen würden dann wieder höhere Werte erreicht. Hier spiele vor allem die vielfach bis heute bestehende Neigung zu Korruption und Vetternwirtschaft gerade auf kommunaler und regionaler Ebene eine große Rolle, die viele Wähler abschrecke und die es dringend zu bekämpfen gelte, so Vodička. Auch scheine sich eine geographische Nähe zu westlichen Staaten grundsätzlich positiv auf die Qualität der Demokratie in den Ländern Ostmitteleuropas auszuwirken. So schneide bei bestimmten Indikatoren Tschechien regelmäßig ähnlich ab wie Ostdeutschland, Slowenien wie Österreich, Ungarn wie die Slowakei, aber eben auch Rumänien wie Bulgarien und Weißrussland wie Russland. Es sei daher auch zukünftig geboten, die Heranführung dieser Staaten an den Westen weiter zu intensivieren, um die Zufriedenheit und die Bereitschaft zur Partizipation mit, respektive in diesen Demokratien zu steigern.
Der zweite Teil der Fallstudien legte den Fokus vor allem auf die Staaten Ost- und Südosteuropas. Den Auftakt hierzu machte Christina Griessler, wissenschaftliche Mitarbeiterin für das Netzwerk Politische Kommunikation (netPOL) an der AUB, die in ihrem Vortrag der Frage nachging, wie die Staaten des Westbalkans die aktuellen Herausforderungen bewältigen würden. In den Staaten des Westbalkans, worunter man Albanien sowie die ehemaligen Staaten Jugoslawiens unter Ausschluss Sloweniens und Kroatiens verstehe, sei vor allem die Förderung und Sicherung des Rechtsstaats fundamentale Grundlage für funktionierende Demokratien. „Der Rechtsstaat kann nicht alles leisten, aber wenigstens verhindern, dass sich einige alles leisten können.“ Dieses Zitat von Ernst Reinhardt aus dem Jahre 2003 sei Sinnbild für die stabilisierende Wirkung funktionierender Rechtsstaaten – eine Wirkung, welche Einfluss auf die gesamte Region habe. Wie Griessler weiter ausführte, erfolge die Förderung demokratischer Strukturen auf zwei Arten: zum einen durch die EU als externen Akteur, zum anderen durch staatsinterne Maßnahmen. Vor allem die Förderung durch die EU jedoch stelle die Staaten aufgrund ihrer innerstaatlichen instabilen Strukturen vor große finanzielle und administrative Herausforderungen: Reformforderungen der EU, noch nicht gelöste territoriale Fragen, dazu das anhaltende Problem der Korruption sowie inter-ethnische Spannungen scheinen die Staaten des Westbalkans vor beinahe unlösbare Aufgaben zu stellen, die von den Institutionen der einzelnen Ländern nur schwer zu bewältigen seien. Zudem würden die Staaten immer noch unter den „Vermächtnissen“ ihrer politischen und wirtschaftlichen Transformation leiden. Die EU jedoch, so Griessler, habe dieses Problem erkannt und trete vermehrt als Vermittler bei der Bewältigung dieser Probleme auf. So lasse sich die EU als aktiver Akteur im Westbalkan bezeichnen, der zudem größtenteils akzeptiert werde. Offen blieb die Frage, ob dies aufgrund eines Mangels an Alternativen oder des Drucks durch die EU geschehe.
Helmut Fehr, Herder-Dozent für Europäische Regionalforschung an der AUB, wandte sich mit Polen einem Staat zu, welcher aufgrund der Parlamentswahlen im Oktober 2015 in aller Munde war. Er beschrieb Polen zu Beginn seines Vortrages als ein Land der Widersprüche, in welchem Wirtschafswachstum zum Wohlstand des Landes beitrage, die Strukturprobleme der politischen Parteien jedoch gravierende Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft haben. Die Parteienentwicklung sei durch politische Fragmentierung und Milieuparteien ohne Verankerung in die Gesellschaft geprägt. Zudem könne von einem pluralistischen Parteiensystem keine Rede mehr sein. Zu dieser parteipolitischen Entwicklung käme eine Ambivalenz Polens in der Außen- und Sicherheitspolitik. Neben einer Abwertung des europäischen Rahmens bestehe der illusorische Wunsch, Partner der USA zu werden. Zur gleichen Zeit wachse das Misstrauen gegenüber Russland und die Annäherung Deutschlands an Russlands werde mit großer Skepsis verfolgt, so Prof. Fehr. Zudem lasse sich ein Gesellschafts- und Wertewandel in Polen beobachten. Kaczyńskis Plädoyer für einen starken Staat ließe sich als Zeichen antiliberaler Tendenzen verstehen. Hinzu komme ein ebenfalls durch Kaczyński geprägtes Verständnis von Politik als Kampf, welches durch Populismus und einen unerschütterlichen Patriotismus gefestigt werde. Als Konsequenz bescheinigte Fehr Polen eine nur schwach entfaltete demokratische politische Kultur, in welcher informelle Wege der Entscheidungsfindung immer wichtiger und Kaczyńskis Selbstverständnis als Anführer, der keiner demokratischen Legitimation bedürfe, immer offensichtlicher werden würden.
In einem sehr praxisorientierten Vortrag stellte Csaba Madarász, der in den vergangenen 20 Jahren an zahlreichen Projekten zum Thema e-democracy beteiligt war, den Gesetzgebungsprozess Ungarns in den Vordergrund und erörterte die Frage, inwiefern der bewusste Missbrauch von Informationen und der damit verbundene Transparenzrückgang eine neue Form der Korruption darstelle. Er begann seinen Vortrag mit einem Beispiel aus seinem eigenen Berufsleben, welches deutlich demokratische Defizite im ungarischen Gesetzgebungsprozess offenlegte. Madarász war im Vorfeld der Verabschiedung des ungarischen Korruptionsgesetzes, welches am 1. April 2010 in Kraft getreten ist, an d Ausarbeitung beteiligt. Als das Gesetz zur Abstimmung in die Nationalversammlung kam, musste er feststellen, dass völlig neue, ihm unbekannte Gesetzespassagen eingefügt worden waren, was beispielhaft für die Fehler in der ungarischen Gesetzgebung sei. Die größten Fehler in diesem Zusammenhang seien die mangelnde Kontrolle der Gesetzesvorschläge einzelner Abgeordneter und ein prägnanter Mangel an Transparenz im Rahmen dieses Verfahrens. So sei es Ministern möglich, Gesetzesvorschlägen neue Elemente hinzuzufügen ohne jegliche Konsultation. Zudem kritisiere Transparency International Ungarn, dass es immer noch keine umfassende Regulierung im Bereich des Lobbying gebe. Auch GRECO (Group of States against Corruption) mache deutlich, dass jegliche Gesetzesvorschläge ein gewisses Maß an Transparenz und erfolgter Konsultation aufweisen müssten. Entsprechend seinen eigenen Erfahrungen konkludierte Madarász, dass der Prozess der Gesetzgebung in Ungarn keinerlei sozialer Kontrolle unterliege und dies ein klares Demokratiedefizit darstelle.
Demokratie jenseits des Nationalstaats
Das dritte und somit letzte Panel der Konferenz zum Thema „Demokratie jenseits des Nationalstaats wurde von Karl-Heinz Paqué, Lehrstuhl für VWL an der an der Otto-von-Guericke- Universität Magdeburg, eröffnet, der sich in seinem Vortrag mit der Zukunft des organisierten Liberalismus befasste. Dieser stehe, so Paqué, vor großen Herausforderungen, obwohl mit dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs eigentlich gute Voraussetzungen für einen funktionierenden Liberalismus geschaffen worden wären: der Sieg der liberalen Demokratie, die beschleunigte Globalisierung und eine sich entwickelnde Informationsgesellschaft. Dass trotz dieser Individualisierung des Lebens von einem Siegeszug des Liberalismus nicht die Rede sein könne, habe laut Paqué mehrere Gründe. Zum einen habe die wettbewerbliche Marktwirtschaft in Verbindung mit einem scharfen Strukturwandel viele Verlierer hervorgebracht. Zum anderen sei die deutsche Wiedervereinigung ebenfalls nicht förderlich für die Entwicklung des Liberalismus gewesen, sei im Osten die Staatsgläubigkeit doch um einiges höher. Auf europäischer Ebene kamen die Euro- und Flüchtlingskrise dazu, welche für eine große Zerrissenheit im liberalen Lager gesorgt hätten – eine Zerrissenheit, welche sich seit den Terroranschlägen in Paris eher nochmals zugespitzt habe. Diese Entwicklungen hätten sich schlussendlich auch im Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag im Jahre 2013 gezeigt. Dass man daraus jedoch gelernt habe und der organisierte Liberalismus auf einem guten Weg sei, zeigten die Entwicklungen in Österreich (NEOS), Holland (D66) und Polen, wo liberale Parteien bei Wahlen durchaus positive Ergebnisse erzielen konnten.
Zoltán Pállinger hielt anschließend einen Vortrag zum Thema „Konzepte der kosmopolitischen Demokratie“. Unter Kosmopolitismus verstehe man Weltbürgerschaft: Diese Zugehörigkeit eines Weltbürgers zu einer Weltgemeinschaft und die damit verbundene Notwendigkeit der Schaffung einer rechtlichen Rahmenordnung, welche als gemeinsamer Bezugsrahmen die Rechte und Pflichten der Bürger garantiere, stelle die Kernproblematik der kosmopolitischen Idee dar. Der Staatsrechtler und Philosoph Carl Schmitt hält die Schaffung einer solchen Weltgemeinschaft oder eines Weltstaates für unmöglich, da er der Meinung sei, eine Gemeinschaft könne nicht ohne einen gemeinsame Identität, also die Abgrenzung von den anderen existieren (Freund-Feind-Unterscheidung). Zudem stellt sich die Frage nach den Ordnungsprinzipien eines solchen Weltstaates: Sollte dieser eher universalistisch begründet sein und das Individuum in den Vordergrund stellen, oder partikularistisch und der Gesellschaft den Vorrang geben?
Wichtige Grundsteine für die aktuelle Kosmopolitismus-Debatte seien bereits von Immanuel Kant gelegt worden, wie Pállinger ausführte. Kant zufolge könne die Freiheit des Einzelnen in einer Gemeinschaft nur gewährleistet werden, wenn die Menschen sich einem allgemeinverbindlichen (vernünftigen) Recht unterwerfen. In seinem Werk „Zum ewigen Frieden“ (1795) konzipierte er drei Rechtsebenen: Staatsrecht, Völkerrecht und Weltbürgerrecht. Die Basis für den internationalen Frieden verankert er hierbei auf der innerstaatlichen Ebene (vgl. Theorie des demokratischen Friedens). Andere Autoren des späten 18. Jahrhunderts, wie Anacharsis Cloots, forderten die Abschaffung der bestehenden Staaten und ihre Ersetzung durch einen Weltstaat. Neben moralischen und philosophischen Überlegungen zum Kosmopolitismus entstanden zu ebendieser Zeit auch ökonomische Konzepte für die Erhaltung des weltweiten Friedens. Vertreter des Freihandelspostulats etwa glaubten an die These: Frieden durch Freihandel. Diesem Dogma widersprechend sah Karl Marx die einzige Chance für eine Einheit der Menschheit in der Vereinigung des weltweiten Proletariats. Im Anschluss an diese allgemeine Verortung legte Pállinger zum einen den derzeitigen „Zustand des Kosmopolitismus“ dar und gab zum anderen einen Ausblick (Cosmopolitan Outlook). Zukünftig denkbar wäre ein moralischer, ein politischer oder ein ökonomischer Kosmopolitismus. Alle drei Konzepte haben ihre Vor- und Nachteile. Abschließend hielt Pállinger fest, dass die durch den Kosmopolitismus konstatierte fundamentale Gleichheit aller Menschen ein sehr erstrebenswertes Konzept sei, dass aber sowohl die Realisierbarkeit als auch die Wünschbarkeit kosmopolitischer Ideen umstritten sei.
In einem Vortrag zum Thema deliberative Demokratie im internationalen Kontext stellte Christoph Good, Oberassistents für Völkerrecht und Internationalen Menschenrechtsschutz an der AUB, die sog. Multi-Stakeholder-Konsultationen vor. Der Begriff „Multistakeholderism“, der eigentlich in der Betriebswirtschaftslehre zu verorten ist, beschreibe freiwillige Zusammenschlüsse zwischen öffentlichen, zivilgesellschaftlichen und privaten Akteuren mit dem Ziel der Lösung komplexer, gesellschaftlicher Probleme in kooperativer Weise, wie Good in einer anfänglichen Begriffsannäherung erläuterte. Die Besonderheit dabei sei, dass die Normen von den Stakeholdern selber geschaffen werden, wodurch sich eine Beförderung von Legitimation versprochen werde. Da Völkerrecht aber originär als Staatenrecht zu verstehen sei, gebe es nur punktuelle Durchbrechungen wie etwa im Rahmen von internationalen Arbeitsorganisationen oder Klimakonferenzen. An einem Praxisbeispiel veranschaulichte Good anschließend, wie das sogenannte Montreux-Dokument, in welchem die Rolle und Verpflichtung der Staaten beim Einsatz von privaten Militär- und Sicherheitsdienstleistern in bewaffneten Konflikten geklärt wurde, zur Schaffung eines selbstverpflichtenden Branchenstandards (International Code of Conduct for Private Security Service Providers) geführt habe, welches von mehr als 700 Unternehmen unterzeichnet wurde und in der Schweiz und Großbritannien sogar Zugang in Gesetze gefunden habe. Die Frage, ob diese neue Form der Normsetzung eine Chance oder doch eher ein Risiko für die Demokratie sei, war Bestandteil des letzten Teils des Vortrags. Veränderte Normsetzungsgewohnheiten auf überstaatlicher Ebene seien grundsätzlich als Demokratiegewinn zu verstehen, so Good. Berechtigt sei jedoch auch die Frage, inwiefern nur eine Transnationalisierung von Demokratieproblemen stattfinde. Dennoch bestehe eine unbedingte Notwendigkeit der Einbindung der Multistakeholder-Ansätze in die noch wenig ausgeprägte internationale Rule of Law Debatte.
Als letzter Referent widmete sich Stefan Okruch, Professur für Wirtschaftspolitik an der AUB, dem Verhältnis von Demokratie und Kapitalismus. Er ging der Frage nach, ob Demokratie ohne Kapitalismus möglich sei. Demokratie wurde dabei als von Partizipation abhängiges Regierungshandeln, der Kapitalismus als liberale Marktwirtschaft definiert. Sowohl Wirtschaft als auch Demokratie unterlägen einer Evolution und seien daher als dynamische Prozesse zu betrachten. Wenn es innerhalb dieser Prozesse zu einer Trennung von demokratischen Regierungsprozessen und Kapitalismus käme, wäre dies nur ein normaler Vorgang, der in der Geschichte gerade in Krisensituationen immer wieder vorgekommen sei, so Okruch. Regieren sei so nicht vom Markt abhängig und auf der anderen Seite die Marktwirtschaft auch nicht vom Staatshandeln vereinnahmt. Wichtig sei aber, dass nach Krisensituationen Demokratie und Kapitalismus wieder in Einklang zueinander fänden, da eines der wesentlichen Versprechen der Demokratie Wohlstand sei, der am ehesten durch Marktwirtschaft garantiert würde.
Abschließend zogen die Organisatoren, Ellen Bos und Zoltán Pállinger, ein konzeptionelles und inhaltliches Fazit. Insgesamt fiel das Fazit durchaus positiv aus, sodass Pállinger sich der Zustimmung der anwesenden Teilnehmer sicher sein konnte, als er anmerkte, dass man sich wohl in 100 Jahren immer noch über die Unzulänglichkeiten der Demokratie streiten und trotzdem gern in einer solchen leben werde.
Text: Ádám Brassói, Nicolas Burgholzer, Stefan Drexler, Tobias Haußmann, Franziska Vesely

 STUDIERENDE
STUDIERENDE


 ETN
QuickLinks
Kontakt
ETN
QuickLinks
Kontakt
 Stipendien
Stipendien
Studiengänge
Promovieren an der AUB
Bewerbung
Alumni
Stipendien
Stipendien
Studiengänge
Promovieren an der AUB
Bewerbung
Alumni
 Web Feedback
Veranstaltungsnewsletter
Web Feedback
Veranstaltungsnewsletter