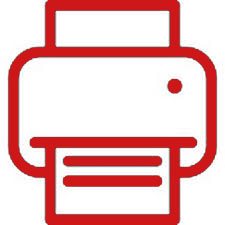Zwanzig Jahre nach der im Zeichen einer „Wiedervereinigung des Europäischen Kontinents“ stehenden größten Osterweiterung der Europäischen Union um die Länder Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien und Ungarn, gefolgt von Bulgarien und Rumänien und später noch Kroatien, steht der Befund einer komplexen Baustelle.
Anstelle der anfänglichen Euphorie hat sich ein Gefühl der Ernüchterung Raum geschaffen. Konfligierende Interessen, beispielsweise über die Verabschiedung des mehrjährigen Finanzrahmens für 2021-2027, die Reaktionen auf die Covid-Pandemie, die Krise der Rechtsstaatlichkeit aber auch ganz grundsätzliche unterschiedliche geopolitische Bedrohungsperzeptionen führen zu harten Auseinandersetzungen innerhalb der Mitgliedstaaten.
Zu Beginn der Europakonferenz der Andrássy Gyula Universität unter dem Titel „Europäische Perspektiven – Die EU 20 Jahre nach der Osterweiterung“ steht der nüchterne Befund, dass der innere Zusammenhalt der Union und die gemeinsame Wertegrundlage nicht mehr als gegeben vorausgesetzt werden können. Das Ziel einer wie auch immer sich ausformenden aber jedenfalls immer engeren Union wird zunehmend in Frage gestellt und diese Tendenz akzentuiert sich durch den imperialen Krieg Russlands gegen die Ukraine im Sinne einer strategischen Herausforderung weiter aus. In ihrem Wesenskern ist die Union ein zivil geprägter und eher wirtschaftlicher Zusammenschluss, an den nun immer mehr der Imperativ einer angemessenen Reaktion auf die grundsätzlichen geostrategischen Herausforderungen herangetragen wird. Sie steht vor der Aufgabe, die Wirtschaft und Bevölkerung zuverlässig und erschwinglich mit Energie zu versorgen, ohne die langfristige ökologische Perspektive aus den Augen zu verlieren. Wenn sie auch künftig als ernstzunehmender globaler Akteur wahrgenommen werden will, muss die Europäische Union nicht nur ihre militärische Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit kritisch prüfen, sondern auch Antworten auf die weltpolitischen und als Unordnung wahrgenommen Umwälzungen im internationalen System durch den Aufstieg neuer Großmächte finden. Die dritte Veranstaltung der Konferenzreihe „Europäische-Perspektiven“ steht in der Tradition, einen Beitrag zum besseren Verständnis des gegenwärtigen Standes und der Perspektiven der europäischen Integration zu leisten. In diesem Sinne haben die Professoren Ellen Bos und Zoltán Tibor Pállinger als Veranstalter für die aktuelle Auflage das doppelte Ziel ausgegeben, einerseits eine Bestandsaufnahme der Entwicklungen in den letzten beiden Jahrzehnten zu erstellen und andererseits die Perspektiven zu erörtern, die sich der EU nach den Europawahlen 2024 stellen. Dabei kreisen die jeweiligen Forschungsbeiträge um die zentralen Fragen der Integrations- und Erweiterungsdynamik und der geopolitischen Handlungsfähigkeit sowie Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Modells.

Den weit mehr als nur symbolischen Aufschlag macht dabei Prof. Dr. Péter Balázs mit seinem Eröffnungsvortrag unter dem Titel „Lessons learned from the ´big enlargement´“. Als Direktor des Center for EU Enlargement Studies der Central European University, ehemaliger Außenminister Ungarns und ehemaliges Mitglied der Europäischen Kommission schöpft er dabei aus einer reichen Fülle an Erfahrungen. In seinen einleitenden Worten verbindet Balázs tiefe anekdotische Erinnerungen aus den Zentren der Europapolitik mit analytischem Scharfsinn und er bereitet derart den folgenden akademischen Auseinandersetzungen einen exzellenten Boden.
Die Konferenz strukturiert sich in vier Panels zu je drei Diskussionsteilnehmerinnen und - teilnehmern. Das erste Panel steht unter der Überschrift „Von der EU-phorie zur Integrations- und Erweiterungsmüdigkeit“. Prof. Michael Gehler referiert hierbei über Europas Strategie- Suche nach der großen Erweiterung 2004/07 und versucht sich an einer aktuellen Zustandsanalyse. An Strategien mangelt es nach Gehler nicht, viel mehr rückt er die seit über zwanzig Jahren offene Frage nach der Finalität der inzwischen mehr als 70 existierenden Strategien ins Zentrum seiner Analysen.
In welcher Zielvorstellung sollen all die Strategien denn zusammenlaufen, wie und anhand welcher Kriterien kann hier priorisiert werden? Die Ursachen dafür, warum zum Beispiel das Thema Demokratieförderung nicht (mehr) auf der von Gehler vorgeschlagenen Prioritätenliste steht, lassen sich aus Prof. Zoltán Tibor Pállingers Analysen zu diesem Gegenstand herleiten. Pállinger geht unter der Leitfrage „Das Scheitern der externen Demokratieförderung?“ den inneren Wiedersprüchen und Spannungsfeldern jener Politik nach. Mit Stationen bei Kant, Hegel, Fukuyama, Whitehead und Applebaum zeigt Pállinger die Komplexität einer theoretischen Verortung der externen Demokratieförderung auf. Am Ende steht der empirische Befund, dass, wenngleich angeschlagen in für Demokratien recht stürmischen Zeiten, die Modernisierungsthese, welche der externen Demokratieförderung ihr teleologisches Legitimationsnarrativ verschafft, bisher mitnichten an der Wirklichkeit gescheitert ist.

Dr. Christina Griessler nimmt dann das Plenum abschließend wieder mit in die ersten Ränge der von Gehler vorgeschlagenen Prioritätenliste für die EU, namentlich den Westbalkan. Griessler zieht eine Verbindung zwischen der anfänglichen Dynamik in der Erweiterungspolitik mit dem sog. Association-Trio (Ukraine, Moldau und Georgien) und deren schleppenden Fortgang mit den Staaten des Westbalkan. Am Anfang steht eine doppelgelagerte Relativierung: Zum einen ist die Dynamik hinsichtlich der neuen Kandidaten wohl mehr Rhetorik denn Semantik und andererseits ist bei den „alten“ Kandidaten aus dem Westbalkan auch nicht keine Dynamik zu beobachten, zumindest nicht in einzelnen Bereichen. Jedoch zeigt Griessler Land für Land über den ganzen Westbalkan auf, dass diese Staaten zunehmend das Interesse an der EU verlieren und sich gezwungen sehen, ihre eigenen Probleme unabhängig zu lösen. Die EU als langfristige Perspektive hat nach Griessler spürbar an Relevanz eingebüßt. In der Frage nach der politischen Verantwortung kann hier aber niemandem der schwarzer Peter nach dem Satz vom ausgeschlossenen Widerspruch zugeschoben werden, vielmehr braucht es hier eine differenzierende Analyse.
Im zweiten Panel diskutieren Botschafter Dr. Robert Klinke, deutscher Inhaber des Lehrstuhls für Diplomatie II, Dr. Mariano Barbato und der österreichische ex-Diplomat Dr. Ferdinand Trauttmansdorff unter der Überschrift: „Die EU zwischen „Supermacht“ und „Supermarkt““.

Klinke fokussiert dabei einleitend auf die geostrategischen Beiträge Mitteleuropas in der EU. Sein Kernargument lautet, dass die EU durch die Osterweiterungen die Basis geschaffen hat, von der aus sich eine geopolitische Akteursqualität überhaupt erst denken lässt. Daraus deduziert Klinke optimistisch eine als Imperativ getarnte Deskription: Mit dem Blick nach außen muss die EU ein Rollenverständnis im Sinne eines eigenständigen handlungsfähigen Akteurs realisieren, tatsächlich kann sie gar nicht anders. Wo andere Herausforderungen oder gar Bedrohungen sehen, formuliert Klinke diese als notwendige Voraussetzungen für dringend anstehende Veränderungen. Barbato zielt dann unter dem Titel „Strategische Neuorientierungen? Handlungsoptionen Deutschlands in Europa“ auf ein Land im Zentrum der Europäischen Union, von dessen außen- und europapolitischen Entscheidungen viel abhängt. Deutschland, so Barbato, konnte es sich in den letzten Jahren recht gemütlich machen in seiner Doppelrolle zwischen der „Vollendung des langen Weges in den Westen“ einerseits und als „Zentralmach in Europa“ andererseits. Dass es mit dieser Gemütlichkeit nicht nur langsam, sondern jetzt und sicher vorbei ist, weiß er dabei in theoretischer Herleitung wie empirischer Darlegung umfassend zu erörtern. Die Perspektiven und Dilemma eines der großen Länder der EU ergänzt Trauttmansdorff, dieses Panel abschließend, um solche Perspektiven eines kleineren Staates, namentlich Österreich. Sein rechtswissenschaftlicher Einschlag bereichert die Debatte um eine weitere Analyseperspektive auf die zur Diskussion stehende phänomenale Gemengelage. Trauttmansdorff zieht hierbei zwei zentrale Schlüsse. Zum einen stellen sich für Österreich aber auch kleine Mitgliedstaaten im Allgemeinen inzwischen strukturelle Herausforderungen in der Nachbarschaftspolitik ein, und zum anderen spielt der rechtspolitische Ansatz der EU, insbesondere das vielbeschworene aber oft als dysfunktional wahrgenommene Subsidiaritätsprinzip, eine zentrale Rolle. Österreich sieht sich mit der Herausforderung konfrontiert, wie einerseits nachbarschaftliche Integration in die EU gelingen und gleichzeitig auf die spezifischen Bedürfnisse des Eigenen eingegangen werden kann.

Das dritte Panel fragt nach der Zukunft des Europäischen Modells. Dabei arbeiten Dr. Henriett Kovács, Prof. Kristina Kurze und Prof. Dietmar Meyer an einer Neukalibrierung der Suche nach der richtigen Balance zwischen Wettbewerbsfähigkeit und sozialer Kohäsion. Unter dem Titel „Erinnerungspolitik – zurück in die Zukunft?“ referiert Kovács über die Frage der Deutungshoheit in der ungarischen Erinnerungs- und Identitätspolitik. Was und mit welchen Mechanismen wird erinnert und was wird vergessen? Im Fokus steht dabei die radikale Umstrukturierung der ungarischen Erinnerungspolitik seit 2010 und die so neu konstruierte und mit zu Traumata schon pathologisch überhöhten politischen Niederlagen der Vergangenheit angereicherte nationale Identität. Wer sich darin gefällt, noch heute den Schmerz von Trianon tatsächlich zu spüren, dürfte wenig übrig haben für das, was Kurze anschließend zum Gegenstand ihres Vortrages macht, den Green Deal der Europäischen Union unter dem Titel „zwischen Backlash und weiter so?“. Aber nicht, weil der Deal ein Green enthält, sondern weil sich der Blick ganz auf das Vergangene konzentriert und dort wohl auch verweilen will. Überraschenderweise kann, die Blickrichtung einmal um die Achse gewendet, heute nach Kurze von einem Backlash beim Green Deal soweit keine Rede sein. Natürlich markiert der Krieg in der Ukraine eine Zäsur. Er verschärft die Energiekrise und so die wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen innerhalb der Union. Nichtsdestotrotz lässt sich keine grundsätzliche Abkehr von den Klimazielen beanstanden, wenngleich ihre Umsetzung eine der größten Herausforderungen im komplexen Mehrebenensystem der EU darstellen.
Als ähnlich herausfordernd dürfte dann Meyer die Dynamik interpretieren, welche er den „Fluch der Ressourcen“ nennt, welcher nicht nur Einzug in Europa zu halten scheint, sondern der sich bereits festsetzen konnte. Meyers von der Ökonomie her gespeister Beitrag schafft dabei zunächst eine grundsätzliche Klarheit über den keineswegs in seiner blanken Materialität sich erschöpfenden Ressourcenbegriff. Europa verdankt seinen historischen Aufstieg einer Vielzahl von Ressourcen. Eine wachsende Bevölkerung, technologische und wirtschaftliche Fortschritte, zunehmender Konsum und der Schutz von Eigentumsrechten durch Institutionen sind hierbei nur ein Ausschnitt. Von dieser Fülle haben nach Meyers Urteil eigentlich nur noch die beiden letztgenannten einen Anspruch auf Aktualität und das lässt ihn nach den Ressourcen fragen, auf die Europa in Zukunft bauen kann. Der Fluch der Ressourcen ist nach Meyer keine Frage der Zukunft, sondern er hat Europa längst heimgesucht. Auch Meyer weiß einen Imperativ an Europa zu stellen und er stellt den denkbar größten: Europa muss sich neu erfinden.

Das letzte Panel muss auf seinen dritten Diskutanten verzichten, umso ungeteilter geht die Aufmerksamkeit auf die beiden Vorträge von Dr. András Hettyey und Prof. Ellen Bos. Beide kreisen, wenngleich auf unterschiedlichen Ebenen, um die Frage der ungarischen EU- Ratspräsidentschaft. Hettyey bemüht sich in seiner Zwischenbilanz um ein ausgewogenes Bild. Zwar sei die ungarische Ratspräsidentschaft kein totaler Reinfall, aber eine Erfolgsstory liegt auch nicht vor. Auf technischer Ebene wurde zwar durchaus solide zusammengearbeitet, aber das kann kaum die negativen Schlagzeilen und das insgesamt schlechte Presseecho dieses halben Jahres übertünchen. Hettyey bewertet zügig, um in einem zweiten Teil seine These vom „liberal turn“ der ungarischen Außenpolitik in Zeiten, während die EU sich um einen „realist turn“ bemüht, zur dann durchaus angeregten Debatte zu stellen. Bos geht in die analytische Metaebene und sortiert dabei ihre Argumente um das Spannungsfeld innerhalb der EU zwischen nationaler Souveränität und der Durchsetzung des Rule of Law auf supranationaler Ebene. Souveränitätskonflikte sind nach Bos längst kein isoliertes Phänomen mehr, das nur Ungarn betrifft. Der Vorwurf, die EU untergrabe mit ihrer Politik die nationale Autonomie der Mitgliedstaaten ist eine in Mittelosteuropa wohlbekannte Vokabel, welche Bos um den Begriff der geteilten Souveränität und ein ganz grundsätzliches Nachdenken über den hier relevanten Kernbegriff abschließend wesentlich erhellt.
Simon TAFLER

 STUDIERENDE
STUDIERENDE


 ETN
QuickLinks
Kontakt
ETN
QuickLinks
Kontakt
 Stipendien
Stipendien
Studiengänge
Promovieren an der AUB
Bewerbung
Alumni
Stipendien
Stipendien
Studiengänge
Promovieren an der AUB
Bewerbung
Alumni
 Web Feedback
Veranstaltungsnewsletter
Web Feedback
Veranstaltungsnewsletter