



 ETN
Gyors linkek
Kapcsolat
ETN
Gyors linkek
Kapcsolat
 Studienstart
Ösztöndíjak
Szakok
Ph.D. képzés
Jelentkezés
Alumni
Studienstart
Ösztöndíjak
Szakok
Ph.D. képzés
Jelentkezés
Alumni
 Hírlevélre feliratkozás
Hírlevélre feliratkozás
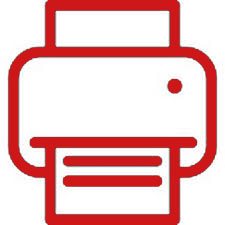
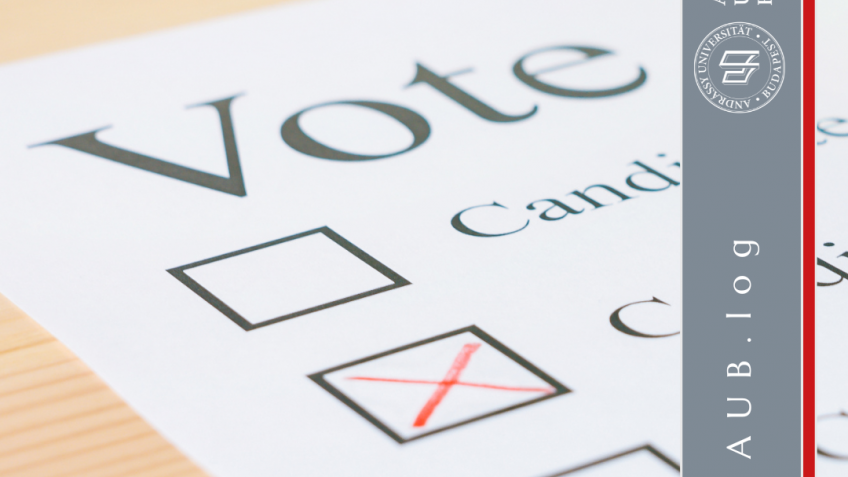
. Friedrich Merz bemühte Mario Draghis legendäre Ansage aus der Zeit der Eurokrise: What ever it takes! Merz zitierte aber nicht nur Draghis Aussage von 2012 Vielmehr hat auch die Kehrtwende der Union bei der Schuldenpolitik ihre Blaupause bei Draghi, in diesem Fall in seinem-Report vom Herbst 2024. Draghi empfahl zur Fortsetzung der Konsolidierung der Europäischen Union massive Investitionen in Verteidigung, Infrastruktur und Klima.
02.04.2025
Am Wahlabend zeichnete sich in den ersten Hochrechnungen eine schwierige Koalitionsbildung ab. Wäre das BSW in den Bundestag gekommen, hätte Unionskandidat Friedrich Merz SPD und Bündnis 90/ Die Grünen für eine Regierungsbildung benötigt. Doch es kam anders. Bald war klar, dass Merz nicht die für ihn ideale Konstellation bekommen würde, in der er nur einen Partner brauchen, aber zwei zur Auswahl haben würde. Doch eine solide schwarz-rote Mehrheit würde ihn ins Kanzleramt tragen können.
Der finanzpolitische Coup in den Sondierungsgesprächen veränderte die Situation jedoch schlagartig und grundlegend. Die Spitzen von Union und SPD kamen schnell überein, dass eine Regierungsübernahme nur mit einer beispiellosen Kreditaufnahme möglich wäre. 400 Milliarden sollten für die Verteidigung, 500 Milliarden für Infrastrukturmaßnahmen zusätzlich aufgenommen werden. Das war wegen der im Grundgesetz festgeschriebenen Schuldenbremse nicht ohne Verfassungsänderung möglich. Die dafür notwendige Zweidrittelmehrheit hatte schwarz-rot aber weder im alten noch im neuen Bundestag. Jedoch im alten Bundestag war die notwendige Mehrheit mit den Grünen zu erreichen, was im neuen Bundestag nicht mehr gegeben war. Im Bundesrat mussten zusätzlich die Freien Wähler in der bayerischen Staatsregierung zustimmen. Diese Operation gelang, wobei die Grünen signifikante Änderungen erreichten. Der Bundestag stimmte am 18. März, der Bundesrat am 21. März mit den notwendigen Mehrheiten zu.
Die Schuldenbremse war im Zuge der Finanzkrise 2009 von einer damals noch mit einer eigenen Zweidrittelmehrheit ausgestatteten schwarz-roten Koalition unter Angela Merkel unterstützt von einer breiten Ländermehrheit beschlossen worden. Die Bremse sollte Deutschland in den Turbulenzen der globalen Finanzmärkte stabile Solidität inklusive niedriger Zinsen und unabhängige Handlungsfähigkeit auf Dauer sichern. Da dafür auf kurzfristige Handlungsoptionen verzichtet werden musste, hatte die Schuldenbremse auch viele Kritiker. Der Wirtschaftshistoriker Adam Tooze, der ein Standardwerk zur Entstehung und Bewältigung der Wirtschafts- und Finanzkrise vorgelegt hatte (Tooze 2018), griff in der Coronakrise das Motto von Mario Draghi aus der Zeit der Eurokrise kritisch gegen die deutsche Schuldenbremse auf: „What ever it takes“ sei grundsätzlich notwendig (Tooze 2021). Während Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble in der Eurokrise mit einem sparsamen Kurs Strukturreformen in ganz Europa erzwingen wollten, gab die Kanzlerin am Ende der Coronakrise nach und stimmte einer gemeinsamen europäischen Verschuldung zu. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen setzte diesen Kurs mit dem Green New Deal fort. Doch diese Auflockerung der Austeritätspolitik auf europäischer Ebene ließ die deutsche Schuldenbremse intakt. Sie wurde während der Pandemie lediglich suspendiert.
Nach der Ära Merkel versuchte die Ampelregierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz nicht benötigte Mittel zur Bewältigung der Coronakrise an der Schuldenbremse vorbei in ein Sondervermögen für die Klimatransformation zu verbuchen. Die Unionsfraktion klagte vor dem Bundesverfassungsgericht und bekam recht. Der dadurch begrenzte Finanzrahmen des Bundeshaushalts führte zum Zerwürfnis zwischen Kanzler Scholz und seinem liberalen Koalitionspartner unter Finanzminister Christian Lindner und letztlich zum Scheitern der Ampelregierung. Im folgenden Bundestagswahlkampf positionierte sich die Union unter Friedrich Merz konsequent im Sinne des von ihr erwirkten Urteils für die Schuldenbremse. Es ging ihr wie unter Merkel um Strukturreformen. Die plötzliche Kehrwende nach der Wahl empfanden manche Kommentatoren als so groß, dass sogar von Verrat gesprochen wurde (Poschardt 2025).
Aus demokratietheoretischer Sicht ist das Aufgeben von Wahlkampfversprechen im Rahmen von Koalitionsverhandlungen weniger problematisch als der Weg für die Verfassungsänderung über die Mehrheiten eines bereits abgewählten Bundestags, weil die Mehrheitsverhältnisse im neuen nicht mehr reichen. Formal korrekt hat das Bundesverfassungsgericht Klagen gegen eine Befassung des alten Bundestags aber abgewiesen. Bis zur Konstituierung des neuen Bundestags ist der alte Bundestag uneingeschränkt entscheidungsfähig.
Begründet wird die Kehrtwende wie die Eile von Friedrich Merz mit einer neuen geoökonomischen und geopolitischen Situation: Donald Trump im Weißen Haus hatte mit seinem Ukrainekurs einer ohnehin mehrheitlich kritisch gegen ihn eingestellten deutschen Öffentlichkeit klargemacht, dass die USA nicht mehr uneingeschränkt die Rolle eines benevolenten Hegemonen spielen werden. Die Ampelkoalition war bereits am Tag der Wahl von Donald Trump zerbrochen. Dieser enge Zusammenhang ist zum einen kontingent und hat zum anderen auch eine rhetorische Qualität. Aber richtig ist schon auch, dass ohne die Bereitschaft der USA, gleichgültig ob in der Finanzkrise damals oder im Ukrainekrieg heute, die Ordnung auf amerikanische Rechnung zu sichern, Europa eigenständiger handeln muss und damit Deutschland in die Pflicht genommen wird, die Last des Hegemonen zu schultern.
Zu dieser neuen Rolle hat sich Friedrich Merz bereiterklärt. Allerdings geht er nicht über den bisher geforderten Weg der Strukturreformen, sondern über die Kreditaufnahme für ein gigantisches Transformationspaket aus Verteidigung, Infrastruktur und Klima. Dieses Paket ist einmal dem Prozedere den Verhandlungen unter drei Partnern geschuldet. Die Union tritt unterstützt von fast allen Kräften für eine Aufhebung der Schuldenbremse zum Aufwuchs der Bundeswehr ein. Die Grünen, deren Zustimmung für die Verfassungsänderung notwendig war, konnten einen erweiterten Sicherheitsbegriff durchsetzen. Statt eines neuen Sondervermögens für die Bundeswehr gilt die Schuldenbremse nun nicht mehr für im weiteren Sinne sicherheitspolitische Ausgaben, inklusive der Unterstützung von völkerrechtswidrig angegriffenen Ländern, sobald die Ausgaben höher als ein Prozent des BIP liegen. Der Nachholbedarf bei der deutschen Infrastruktur ist unumstritten und kann auch als Konjunkturprogramm dienen. Ein Sondervermögen stand aber nicht im Wahlprogramm der Union, das vielmehr auf Einsparungen und Wachstum setzte. Die Grünen sicherten 100 Milliarden der 500 Milliarden des Sondervermögens für die klimapolitische Transformation, schrieben die Ausrichtung des Geldes auf die Klimaneutralität bis 2045 im Grundgesetz fest, wahrscheinlich die folgenschwerste Justierung, und setzten eine Absicherung gegen Umbuchungen durch. Es bleibt aber doch ein Rätsel, warum die Union und Merz dem so leicht zustimmen. Ist die Union einfach ein Kanzlerwahlverein, dem Inhalte im Zweifel weniger wichtig sind? Die Bereitschaft der Union lässt sich nicht nur machtpolitisch, sondern auch inhaltlich erklären. Merz greift nicht nur Draghis Motto aus der Eurokrise auf. Der Draghi-Report vom Herbst 2024 ist auch die Blaupause für die Regierung Merz.
Mario Draghi forderte als Berichterstatter für die EU-Kommission ein massives gemeinsames Investitionsprogramm der EU in Klimatransformation, Infrastruktur und Rüstungsindustrie auf Kreditbasis. Große öffentliche Schulden sollen private Investitionen nach sich ziehen. Auf klimafreundlicher und sicherheitspolitischer Grundlage wäre Europa geeint und global wettbewerbsfähig. Andernfalls drohen Wohlstandsverlust, Klimawandel und Russlands Revisionismus (Draghi 2024).
Im Wahlkampf spielte der Draghi-Report keine Rolle. Finanzminister Linder hatte sich vor seiner Entlassung noch gegen Draghi positioniert, Wirtschaftsminister Robert Habeck dafür. Doch eine disruptive Transformation gegen den Klimawandel zusammen mit dem Aufbau einer europäischen Rüstungsindustrie über Kredit war beim deutschen Wahlvolk wenig attraktiv. Ein Schreckgespenst einer klima- und rüstungspolitischen Plan- und Schuldenwirtschaft der EU, für die Deutschland bürgt, hätte im Wahlkampf vor allem den Rändern nutzen können. Statt im Wahlkampf direkt, fand Draghis Agenda indirekt nach der Wahl den Weg ins Regierungsprogramm.
Draghis Plan und mit ihm das Programm von Merz gehen dann auf, wenn sich eine klimafreundliche Wirtschaft am Weltmarkt durchsetzt und die Investitionen in Wehrtechnik nicht nur Schutz vor Russland, sondern auch technische Innovation bringen. Draghis Vorschlag plädiert für eine Flucht nach vorn. Die bereits beschlossenen klimapolitischen Wegmarken, insbesondere der Emissionshandel für CO2 bei Verkehr und Wohnen ab 2027, der Privathaushalte überall in der EU hart treffen wird, sollen sich finanzpolitisch abgefedert leichter erreichen lassen. Zudem drohen der Exportindustrie Einbußen in China und den USA, die beide mit jeweils unterschiedlichen Ansätzen zunehmend die eigenen Märkte gegen Importe abschotten. Die freigesetzten Kapazitäten aus den exportstarken Sektoren benötigen neue Betätigungsfelder. Eine dauerhafte Umlenkung in staatlich dominierte oder zumindest staatlich induzierte Bereiche von Rüstung, Klima und Infrastruktur würde die europäische Ökonomie nachhaltig verändern.
Mit viel Geld und Disruption lässt sich Wachstum erzielen. Schumpeters klassisches Konzept der kreativen Zerstörung funktioniert aber nur dann effektiv, wenn die neue Form des Wirtschaftens sich nach der Initialzündung selbst trägt und auf ein höheres Niveau führt. Andernfalls bleibt es bei der Zerstörung. Merz schließt sich mit seinem Regierungsprogramm, dessen Finanzierungsvolumen und Eingriffstiefe wie bei Draghi alles in den Schatten stellt, was bisher unternommen wurde, einer sehr riskanten Wette an.
Während Draghi und Merkel in der Eurokrise nur die Kapitalmärkte beruhigten und gleichzeitig Strukturreformen im europäischen Binnenmarkt anstrebten, setzt die klima- und wehrpolitische Transformation an den Grundlagen des europäischen Integrationsprojekts an. Wie im Anfang der erfolgreichen Montanunion und der gescheiterten Verteidigungsgemeinschaft wird auf der Basis politischen Handelns das Fundament der europäischen Ökonomie und Politik neu justiert. In der auf Kohäsion ausgerichteten Integrationsidee geht es dabei auch darum, die in der Eurokrise sichtbar gewordene Schlagseite deutscher Stärke auszugleichen. Deutschland kann deswegen seine Rolle als Vormacht nur dann europakonform spielen, wenn es bereit ist, seinen Vorsprung für die Partner zu opfern. Um ein solches Vorgehen gegenüber dem deutschen Wahlvolk legitimieren zu können, muss der absolute Gewinn für alle so groß sein, dass relative Verluste durch die absoluten Zugewinne für Deutschland überkompensiert werden (Barbato 2024: 284-287).
Wenn Friedrich Merz das gelingt, dürfte er in die Geschichtsbücher als großer deutscher Kanzler eingehen, der Adenauers und Kohls Vereinigungswerk vollendet oder doch zumindest auf eine neue Stufe gehoben hat. Wenn die Wette nicht aufgeht, steht nicht nur Merz vor einem Scherbenhaufen. Deutschland und Europas Wettbewerbsfähigkeit und damit der Wohlstand werden durch fehlgeleitete Investitionen und Überschuldung massiv leiden.
Für die deutsche Demokratie und ihre Parteienlandschaft kommt ein weiteres Problem hinzu. Adenauer und Kohl setzten ihre Projekte ohne, zum Teil gegen die SPD durch. Kritik an der Union konnte auf das Stimmenkonto der Sozialdemokratie gebucht werden. Jetzt geht die Wette nicht nur die Union zusammen mit der SPD ein, die Notwendigkeit einer Grundgesetzänderung holte auch die Grünen mit ins Boot, die inhaltlich ohnehin zu den großen Befürwortern der Draghi-Politik gehören. Über den Bundesrat mussten sogar noch die Freien Wähler gewonnen werden, weil schwarz-rot-grün dort keine Zweidrittelmehrheit hat. Falls wie ausgemacht die Reform der Schuldenbremse im neuen Bundestag fortgesetzt wird, müsste sogar die Linke eingebunden werden. Dann wäre im Deutschen Bundestag nur noch die AfD als Opposition gegen diesen Kurs vertreten. Soll man zur alternativen Absicherung auf eine außerparlamentarische Opposition der FDP hoffen? Merz und mit ihm die ganz große Koalition fast aller Parteien links der AfD gehen eine extrem riskante Wette ein. What ever it takes? Well, failure is not an option!
Mariano Barbato
Literatur
Mariano Barbato, Wetterwechsel. Deutsche Außenpolitik von Bismarck bis Scholz, zweite erweiterte und aktualsierte Auflage, Frankfurt am Main /New York: Campus 2024.
Mario Draghi, The Future of European competitiveness, September 2024. https://commission.europa.eu/document/download/97e481fd-2dc3-412d-be4c-f152a8232961_en?filename=The%20future%20of%20European%20competitiveness%20_%20A%20competitiveness%20strategy%20for%20Europe.pdf
Ulf Poschard, Der Verrat, Welt, 07.03.2025, https://www.welt.de/debatte/plus255612014/Friedrich-Merz-Der-Verrat.html
Adam Tooze, Crashed. Wie zehn Jahre Finanzkrise die Welt verändert haben. München: Siedler, 2018
Adam Tooze, Welt im Lockdown. Die globale Krise und ihre Folgen. München: C.H. Beck, 2021.