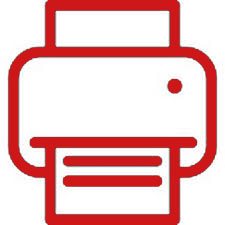Vom 10. bis 12. Oktober fand unter dem Titel „Politische Kultur in der Demokratie – Herausforderungen für Politiker und Bürger“ eine vom Donau-Institut für Interdisziplinäre Forschung, der Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften und der Fakultät für Internationale Beziehungen der Andrássy Universität Budapest (AUB) organisierte internationale Tagung statt. Die Konferenz unter Leitung der AUB-Professoren Prof. Dr. Ellen Bos, PD Dr. Hendrik Hansen und Dr. Zoltán Tibor Pállinger fokussierte sich auf die „weichen“ Faktoren der politischen Kultur, wie etwa Werte und Demokratieverständnis, und griff diesbezügliche aktuelle Problemlagen aus unterschiedlichen Perspektiven auf. Finanziell Unterstützt wurde die Veranstaltung vom DAAD und dem Deutschen Auswärtigen Amt. Das umfangreiche Programm der Tagung gliederte sich in zwei Teile zu jeweils vier Paneln und einer Podiumsdiskussion.
Teil I: Bedrohung der Demokratie?
Panel 1: „Bedrohung der Demokratie?“
Der erste Teil der Tagung stand unter dem Titel „Bedrohung der Demokratie?”, ebenso das erste Panel, in dem zunächst Prof. Dr. Barbara Zehnpfennig, Professorin für Politische Theorie und Ideengeschichte an der Universität Passau, referierte. Laut Zehnpfennig bestünden Gefährdungen der Demokratie sowohl von außen, etwa durch Krieg, supranationale Institutionen wie die Europäische Union oder die globalisierte Wirtschaft, als auch von innen, etwa durch die Erosion des demokratischen Bewusstseins. Sie unterstrich die Bedeutung der Gefährdungen von innen und hob zwei Punkte hervor: die Einstellungen von Bürgern in politischen Prozessen und aktuelle Krisensymptome. Die Einstellungen der Bürger können, Marx folgend, ausschließlich ökonomisch determiniert sein, oder – was in den westeuropäischen demokratischen Wohlfahrtsstaaten heute eher zutrifft – in einem spannungsvollen Wechselverhältnis stehen. Die Hauptfrage lautet hierbei, inwieweit sich Bürger mit ihren politischen Systemen identifizieren können. Hier kam Zehnpfennig zu ihrem zweiten, von folgenden Fragen geleiteten Punkt: Wie wird Demokratie geschwächt? Wie findet eine innere Erosion des demokratischen Bewusstseins statt? Als Antwort nannte sie vier Merkmale: erstens das Fehlen der totalitären Erfahrung (vor allem bei Bürgern im Westen Europas) beziehungsweise die falsche Aufarbeitung totalitärer Erfahrung (im postkommunistischen Mittel- und Osteuropa); zweitens die Annahme vieler, dass Parteien kaum die Interessen der Bevölkerung repräsentieren und Politik in Demokratien lediglich eine Herrschaft von Berufsfunktionären sei; drittens das bescheidene Engagement der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei Wahlen und in Parteien; viertens schließlich die überproportionale Bedeutung der Ökonomie: eine Art ökonomischer Kosten-Nutzen-Rechnung, die viele Bürgerinnen und Bürger auch auf den politischen Bereich anwenden. Zehnpfennig resümierte, dass Demokratien Krisen vertragen, sofern der Bürger überzeugt bleibt, dass er im demokratischen System in der besten, aber auch anspruchsvollsten aller Staatsformen lebt.
Prof. Dr. Wilhelm Hofman, Professor für Politische Wissenschaft an der Technischen Universität München, stellte im zweiten Teil des ersten Panels die Frage, inwieweit massenmediale Kommunikation eine Bedrohung für die Demokratie sei. Die Nutzung und des Einflusses der Medien könne für die politischen Akteure durchaus Destruktionspotenzial enthalten, so Hofmann. Dieses entfalte sich erstens durch einen Glaubwürdigkeitsverlust, der in der Unterhaltsamkeit der Sendung begründet ist; zweitens durch eine Schaupolitik, die ein Auseinandertreten von bürokratischer Entscheidung und Politiksimulation vor Augen führt; drittens schließlich durch Manipulationen und
Zensuren, die Reaktionen vornehmen können. Destruktionspotential ist auch auf der Ebene des Demos feststellbar. Medien generieren eine „absolute Nähe der gesehenen Sache” (Baudrillard). Die komplexe Interdependenz von Bürger und Medien mache sich bemerkbar durch einerseits die steigende mediale Integration und Ausweitung formaler demokratischer Rechte, andererseits jedoch stellen wir eine diffuse mediale Integration bei gleichzeitig starker Differenzierung der Lebensformen fest. Dieser „Cocktail“ habe einen schleichenden Verlust von „Sinn” zur Folge. Hofmann schließt mit der Erkenntnis von Jürgen Habermas, dass diese neue Situation den Verständigungs- und Interpretationsbedarf steigen lässt, und somit auch das Risiko des Dissens höher ausfällt. Hofmann fügt noch pessimistisch an: Je enttäuschender das Problemlösungspotential in unseren medialen Wirklichkeiten, desto höher ist die Bereitschaft zu politischen Extremismen. Diskutiert wurden im Anschluss insbesondere die hohen Erwartungen der Bürger an das demokratische System, die vor allem durch mehr Bürgerbeteiligungen befriedigt werden können. Ein allgemeines Manko sei, so Zehnpfennig, dass Politik zu wenig argumentativ gestaltet und kommuniziert würde: Es würden nur noch Ergebnisse kundgetan (ein Umstand, der teils den kurzen Sendezeiten zuzuschreiben ist). Bürgerinnen und Bürger würden auch oftmals Partizipation als ein simples Sich-Durchsetzen missverstehen. Demokratische Politik sei jedoch ein langwieriger Prozess des Verhandelns und der Kompromiss- und Konsensfindung.
Panel 2: „Demokratie zwischen Individualismus und Gemeinwille“
Das zweite Panel trug den Titel „Demokratie zwischen Individualismus und Gemeinwille“. Diskussionsleiter PD Dr. Hendrik Hansen, Professur für Politikwissenschaft und Dekan der Fakultär für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften der Andrássy Universität Budapest, stellte eingangs fest, dass die Balance zwischen diesen beiden Polen notwendig sei, von den Bürgern gelebt werden und in den Institutionen vertreten sein solle. Der erste Referent war Prof. Dr. Endre Kiss, Professor für Philosophiegeschichte der Eötvös Lóránd Universität Budapest, der Ungarn eingangs als einen „kranke[n] Mann der politischen Kultur“ bezeichnete und dazu acht Hypothesen in den Raum stellte, von denen die wichtigeren hier genannt seien: Konsensbildung sei die große Schwäche der ungarischen Politik, so Kiss. Weiterhin hätte es „kleine Kreise der Freiheit“ (István Bibó) gegeben, die einander 1990 jedoch nicht kannten und deren Verständnisschwierigkeiten Probleme verursacht hätten. Drittens beobachtete Kiss keine oder wenig repräsentative Entscheidungsfindungen, denn diese seien in der Regel autoritäre Akte des Parteiführers nach formalen Sitzungen. Es hätte viertens kein Inventar an gemeinsamen Errungenschaften gegeben, auf die sich alle Parteien im Sinne des Konsenses hätten beziehen können. Schließlich monierte Kiss die „fehlende Autorität des Runden Tisches“, über dessen Vereinbarungen sich Akteure später hinwegsetzten. Der Referent resümierte: Nach 1990 prägte sich eine Kultur nach dem Schema aus, dass sich der Einzelne groß machte, um „in dieser schlechten Mannschaft“ durchzukommen.
Dr. Peter Kainz von der Studienstiftung des Deutschen Volkes in Bonn analysierte als zweiter Referent des Panels die Schriften von John Locke und Alexis de Tocqueville dahingehend, inwieweit das Spannungsverhältnis zwischen „liberalem individuellen Streben“ einerseits und
„demokratischem Mehrheitswillen“ andererseits in Einklang gebracht werden könne. Für John Locke versucht der Mensch stets seinen Eigennutzen zu maximieren. Die Vernunft begrenzt ihn jedoch dabei. Für die Selbstbeschränkung sind insbesondere zwei Werte ausschlaggebend: die Religion, die übertriebenen Gruppenegoismus zu vermeiden hilft, und die Erziehung, die übertriebenen Individualismus in Schranken hält. Locke erkennt dabei Gott als eine fundamentale Prämisse an. Tocqueville legt sein Augenmerk insbesondere auf die negativen Folgen des Begriffs der Gleichheit. Gleichheit generiere eine „geistige Tyrannei der Mehrheit“ (Tocqueville), einen Verlust des Gemeinsamen und führe zu Vermassung. Es sind Menschen mit ihren individuellen Prägungen, die solche Gefahren der Demokratie auszugleichen vermögen. Kainz ging zum Abschluss auf die heutige Situation ein: So sind für ihn postmoderne Werte und die neoliberale Wirtschaftspolitik jene Geisteshaltungen, die das Individuum verabsolutieren und die Dämme, die dem Individuum Grenzen setzen, niederreißen. Entgrenzte Individuen suchen nach neuen Idealen, wenden sich esoterischen Strömungen zu. Die unerfreuliche und unerwünschte Konsequenz dessen wäre eine „entwurzelte liberale Demokratie“, so Kainz.
In der anschließenden Diskussion wurde die Rolle der Religion noch einmal aufgegriffen. Kainz bezog sich dabei auf eine neuere Studie, die die Rolle von Christen als aktivere Bürger unterstrich. Dem wurde in einer Wortmeldung entgegengehalten, dass das Tableau an Variablen, die die Funktionsvoraussetzungen von Demokratie festhalten, weiter zu ziehen ist. Genannt wurden etwa die Absenz von Armut oder der Stand der wirtschaftlichen Entwicklung, denn es sei eine klare Korrelation zwischen einem höheren wirtschaftlichen Wohlstand und der Stabilität von Demokratie in diesen Ländern feststellbar.
Podiumsdiskussion I: Die Entwicklung der Demokratie in Ungarn
Einen Höhepunkt bildete die Abendveranstaltung des ersten Tages, die erste Podiumsdiskussion unter dem Titel „Die Entwicklung der Demokratie in Ungarn“, geleitet von Prof. Dr. Ellen Bos, Professorin für Politikwissenschaft an der Andrássy Universität Budapest und Leiterin des Donau- Instituts für Interdisziplinäre Forschung. Sie stellte eingangs das Spektrum der sehr verschiedenen Meinungen zur ungarischen Demokratie in den Raum: Das eine Extrem seien Stimmen, insbesondere aus dem Ausland, die von einer „Putinisierung Ungarns“ sprechen, das andere Extrem die Statements des 2010 gewählten Premierministers Orbán, der erst mit dem FIDESZ-Wahlsieg von 2010 den Systemwechsel als vollendet betrachtete. Die drei Diskutanten waren Gergely Prőhle, früherer Botschafter Ungarns in Deutschland und heutiger Staatssekretär im Ungarischen Außenministerium, Dr. Georg Paul Hefty, Journalist und ehemaliger Ressortleiter der Frankfurter Allgemeinenen Zeitung, und Zoltán Kiszelly von der Kodolányi János Hochschule in Budapest.
Auf die Eingangsfrage nach der Qualität des Systemwechsels 1990 unterstrich Kiszelly, dass dies ein von den kommunistischen Machthabern, d.h., von oben eingeleiteter Übergang war und seither vor allem die Erwartung nach mehr Wohlstand nicht eingetreten sei. Hefty fragte nach der Definition von Demokratie und dem an sie anzulegenden Maßstab. Er riet, zwischen einer Innen- und Außensicht zu unterscheiden. Prőhle unterstrich das liberale Element des ungarischen Kommunismus. Er hielt jedoch kritisch fest, dass dieses dazu geführt hätte, die Frage der Verantwortung nach 1990 nicht zu stellen. Die Aufarbeitung der Vergangenheit war sodann Gesprächsthema, wobei alle drei Diskutanten auf die inneren Widersprüche der einzelnen Akteure verwiesen: etwa die Koalition, die die Liberalen mit den Sozialisten eingingen; oder der Vorwurf des Nationalismus, der Ungarn nach 1990 wiederholt in Kritik brachte. Eine Publikumsfrage nach einer „Stasi-Behörde“, die eingerichtet werden sollte, verwies auf diese inneren Widersprüche: Im linken politischen Spektrum seien es die Sozialisten, im rechten die katholische Kirche, die an einer adäquaten Aufarbeitung und neuen Institutionen wenig Interesse zeigten und bis heute zeigen.
Prőhle wies auf die Konfliktlinie zwischen Modernisierern und Traditionalisten hin. Insbesondere von außen betrachtet wird Modernität immer mit der politischen Linken verbunden und Tradition immer mit der politischen Rechten. Diese festgelegten Positionen stimmten nicht, sagte er. Kiszelly trat dafür ein, die Konfliktlinie zwischen postsozialistischen versus antikommunistischen Positionen aufzubrechen und plädierte für eine ausgeprägtere Konsenskultur, die mehr Win-Win-Situationen produzieren könne als die heutigen Grabenkämpfe, welche an einen „kalten Bürgerkrieg“ erinnerten. Kann das Wahljahr 2014 einen Wechsel herbeiführen? Obwohl es eine Mehrheit an unentschlossenen Wählern gebe, sei aufgrund des umstrittenen neuen Wahlgesetzes daran zu zweifeln, so der Tenor bei Kiszelly und den Diskutanten aus dem Publikum. Prőhle freilich verteidigte die „Errungenschaften“ der heutigen Regierung und ersuchte um eine Diskussion, die „more relaxed“ sein solle. Das Publikum sah das insbesondere in der Frage der vielen Verfassungsgesetze, die die derzeitige Regierung in „atemberaubendem Tempo“ verabschiede, eher anders. Tagesaktuelle Fragen würden als Verfassungsgesetze beschlossen und zukünftige Regierungen binden, ein Umstand, welcher der Aura und dem Status einer Verfassung nicht unbedingt förderlich sei, so eine weitere Wortmeldung. In einem abschließenden Statement unterstrich Hefty die geringe zu erwartende Unterstützung des Westens der politischen Rechten unter Orbán, ihrer protektionistisch ausgerichteten Wirtschaftspolitik und ihrem Begriff der Nation, der die Ungarn in den Nachbarländern einschließe. Kiszelly sieht Ungarn als ein Laboratorium der Politik, die sich das Ziel der aufholenden Modernisierung zum Ziel setze. Prőhle, wie auch die beiden anderen Diskutanten, verwiesen schließlich auf die Wichtigkeit der Mitgliedschaft Ungarns in der Europäischen Union als Kernelement der Orientierung in der ungarischen Politik.
Bericht von Dr. Christopher Walsch
Panel 3: „Parlamentarismus in der Krise?“
Der zweite Konferenztag begann mit dem dritten Panel unter der der Frage „Parlamentarismus in der Krise?“. In ihrer Einführung knüpfte Prof. Dr. Ellen Bos an die Panels des Vortags an, welche schon einige aktuelle Problemlagen heutiger Demokratien thematisiert hatten, und leitete dann zu den speziellen Herausforderungen für den Parlamentarismus über. Zu nennen seien hier etwa die angemessene Repräsentation des Bürgerwillen angesichts starker Individualisierungstendenzen, das
„Outsourcing“ von Aufgaben an supranationale Akteure, beschleunigte Kommunikationsformen sowie nicht zuletzt auch die sich verdichtenden Hinweise auf einen Bedeutungsverlust der Parlamente, der Fragen nach neuen Partizipationsformen aufwerfe.
Der erste Teil des Panels wurde von Prof. Dr. Petra Dobner, Professorin für Systemanalyse und Vergleichende Politik der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, bestritten. Dobner setzte die Bedeutung demokratischer Legitimität an den Ausgangspunkt ihrer Überlegungen und ging zur Erklärung hierfür auf die Begriffe Parlamentarismus, Parlament und Krise ein. Sei das Parlament am Anfang zunächst ein reines Organ der Artikulation des Volkswillens gegenüber der Exekutive gewesen, habe es heute verstärkt die Aufgabe des Austarierens unterschiedlicher Interessen übernommen – und zwar bei größtmöglicher Effektivität und gleichzeitig höchstmöglicher Legitimation seiner Entscheidungen. Der Parlamentarismus an sich sei dabei im Idealfall von Aufgabenteilung, Diskussion, dem Finden stabiler Mehrheiten, aber auch von politischem (Regierungs-)Wechsel gekennzeichnet. Die heutige Situation stehe nun aber den Funktionen von Parlament und Parlamentarismus entgegen; vielmehr komme es immer häufiger zu einer Entkopplung von Legitimität und Effektivität. Als Beispiel wies Dobner auf die unter Hochdruck durchgeführten Maßnahmen zur Bekämpfung der Finanzkrise hin. Der Krisenbegriff fasse hier zu weit, jedoch seien viele tendenzielle Gefährdungen für das parlamentarische Funktionieren erkennbar. Zu diesen Faktoren gehöre die starke Europäisierung von Entscheidungen (Arenenverlagerung), die Kluft zwischen Hoffnung auf Demokratie und Anti-Haltung gegenüber politischen Vertretern (Anti-Parlamentarismus), ein immer größerer Zeitmangel bei politischen Entscheidungen angesichts gehäufter Bedrohungsszenarien und veränderter Kommunikationsformen (Beschleunigung), sowie schließlich das gehäufte Konstatieren politischer Alternativlosigkeit („Scheinwahrheiten“). Dem Parlamentarismus, ihr Resümee, könnte demgegenüber eine Anfälligkeit für solche Gefährdungslagen attestiert werden.
Der zweite Vortrag des dritten Panels, gehalten von Prof. Dr. Dieter Segert, Professor für Transformationsprozesse in Mittel-, Südost- und Osteuropa der Universität Wien, beleuchtete die Gefährdung des Parlamentarismus aus dem Blickwinkel osteuropäischer Staaten. Deren Lage sei aufgrund der weitgehenden Auswirkungen des Transformationsprozesses im Postsozialismus, des schwachen Sozialstaats sowie der starken sozialen Trennung von Gewinnern und Verlierern gesondert zu betrachten. Segert setzte somit die Gefährdungsfaktoren des Parlamentarismus auch in einen sozialen Kontext: Die demokratische Ordnung, d.h., die Realisierung demokratischer Rechte sei nicht nur institutionell sondern auch von gleichen wirtschaftlichen Handlungsmöglichkeiten einer tragenden Mittelschicht abhängig. In Osteuropa hingegen hätten wirtschaftliche Zwänge oft zu einem Ungleichgewicht, Korruption und der Dominanz intervenierender Veto-Akteure (Interessensgruppen) geführt. Ferner müsse der osteuropäische Parlamentarismus noch Standards des Westens lernen. Besonders problematisch seien hier die Instabilität der Fraktionen bzw. Parteien, der hohe Gesetztes-Output und die schwache Beziehung der Bevölkerung zu den Parteien. Darüber hinaus sei eine Tendenz zur Marginalisierung der Parlamente durch die Regierung zu beobachten. Sie komme dessen „Domestizierung“ gleich, etwa durch Mittel wie der Beschleunigung, dem Verneinen von Alternativen und einem hohen Gesetzesausstoß, welcher Ausschussarbeit und Meinungsbildungsprozesse marginalisiere. Symptomatisch hierfür sei das Beispiel Rumäniens, dessen verschiedene Regierungen seit Mitte der 1990er Jahre über 150 Gesetze per Dringlichkeitsverordnung erlassen hätten. In einem Fazit identifizierte Segert schließlich drei Problemlagen in Osteuropa, auf die Antworten zu finden seien: ein Vertrauensverlust in die Parlamente, eine Entfremdung der Politik von der Wählerschaft sowie übermäßige Machterhaltungstendenzen der jeweils regierenden Parteien.
Panel 4: „Der Konflikt von Freiheit und Gleichheit als Grundproblem der Demokratie“
Das vierte Konferenzpanel beschäftigte sich mit dem Thema „Der Konflikt von Freiheit und Gleichheit als Grundproblem der Demokratie“. Moderator Dr. Zoltán Tibor Pállinger, Professur für Politikwissenschaft und Dekan der Fakultät für Internationale Beziehungen der Andrássy Universität Budapest, hob in seiner Einleitung die Bedeutung der Begriffe Freiheit und Gleichheit für die Entwicklung von und die Voraussetzung für liberale Demokratien hervor. Dabei eröffneten sich für die moderne Politiktheorie gerade hinsichtlich der heutigen Gewichtung der Begriffe und hinsichtlich des Umgangs mit Ihnen viele Fragestellungen.
Im ersten Teil des Panels ging Prof. Dr. Clemens Kauffmann, Professor für Politische Philosophie und Ideengeschichte der Universität Erlangen, auf die Schwierigkeiten bei der Findung des Bedeutungsgehalts der Begriffe Gleichheit und Freiheit ein. Dafür skizzierte er einleitend Entwicklung und Verhältnis beider Begrifflichkeiten: So bedeutete in der Antike die Gleichheit (Isonomia) der Vollbürger zunächst die Übernahme der Geschicke der Polis durch die Bürgerschaft, Freiheit hingegen die – durch Gleichheit erst ermöglichte – Emanzipation von der Herrschaft des Adels. Dabei seien besonders in Aristoteles' Arbeiten beide Begriffe zu wesentlichen Bestandteilen eines auf Gemeinwohl ausgerichteten Staatsaufbaus geworden, Gleichheit mithin ein integraler Bestandteil von Freiheit. Bei Hegel schließlich sei Freiheit nicht mehr bloße Eigenschaft einer Person; vielmehr könne sie erst, da man für sie Anerkennung benötige, in zwischenmenschlichen Beziehungen entstehen. Hieraus resultiere ein Kampf um Anerkennung, der im Rahmen politischer Kultur stattfinden könne. Aufgabe demokratischer Politik sei es daher, zum einen die Präsenz der Bürgerschaft zu gewährleisten, zum anderen die Identität einer politischen Kultur der gegenseitigen Anerkennung zu forcieren. Ein Freiheitsbewusstsein könne demnach nur in einer Demokratie, nicht aber in einer Diktatur entstehen. Für Transformationsgesellschaften bedeute dies eine wesentliche Hürde, da diese eine solchermaßen geartete Identität erst zu entwickeln hätten. Neue Herausforderungen im Streben nach Gleichheit ergäben sich schließlich im Versuch der Nivellierung unterschiedlicher Lebensverhältnisse. Kauffmann führte hier als Beispiele insbesondere die Verteilung (endbarer) Ressourcen oder auch das Streben nach genetischem Egalitarismus (Gentechnik) an. Gerade hier sei das Ausbalancieren von Gleichheit und Freiheit als sich gegenseitig bedingenden Errungenschaften liberaler Demokratien von wesentlicher Bedeutung.
Im zweiten Panelbeitrag beschäftige sich Prof. Dr. Dr. Manfred Brocker, Professor für Politische Theorie und Philosophie der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, mit der Frage, ob „Eigentum“ ebenso ein Grundprinzip des Politischen sei wie „Freiheit“ und „Gleichheit“, um diese gleich zu verneinen. In seiner Argumentation zeichnete er zunächst die historische Entwicklung des Eigentumsbegriffs nach: Die Vorstellung, dass die Legitimität der politischen Ordnung von der Legitimität der Eigentumsordnung abhänge, sei im 17. Jahrhundert aufgekommen, als Naturrechtstheoretiker begannen, „Eigentum“ als unumstößlich anzusehen, da es auf eigener Arbeit und Leistung beruhe. Diese Auffassung spiegele sich noch immer in der Rechtsprechung des deutschen Bundesverfassungsgerichts wider, wenn es mit Blick auf die Eigentumsgarantie des Artikels 14 im deutschen Grundgesetz von einem „eingriffsfesten Wesenskern“ spreche, der dem Gesetzgeber nicht zur Disposition stehe. Die hinter diesen Auffassungen stehenden Begründungen seien aber nicht haltbar, so Brocker. Vielmehr sei „Eigentum“ kein aus einem Guss bestehendes Rechtsinstitut, sondern ein komplexes Bündel aus Rechten, Freiheiten und Kompetenzen und verwies auf die zeitgenössische, amerikanische Rechtstheorie, die von einer „bundle of rights“- Konzeption ausgehe. Der Gesetzgeber könne dieses Bündel nach funktionalen Erfordernissen für verschiedene Rechtssubjekte und Objekte unterschiedlich schnüren. Sofern er demokratisch legitimiert sei und die Grundprinzipien der Freiheit und Gleichheit beachte, sei sein Gestaltungsspielraum weitaus größer, als es die traditionelle Auffassung gelten lassen wolle. Schließlich konstatierte Broker in seinem Fazit überspitzt, dass die Legitimität der Eigentumsordnung von der Legitimität der politischen Ordnung abhänge – und nicht umgekehrt.
Bericht von Adrian Ebner
Teil II: Demokratie in Mitteleuropa
Panel 5: „Verfassungsgebungsprozesse und Postbeitrittskrise in Mitteleuropäischen Demokratien“
Der zweite Teil der Tagung widmete sich der Frage der Demokratie in Mitteleuropa. Es begann mit dem insgesamt fünften Panel zum Thema „Verfassungsgebungsprozesse und Postbeitrittskrise in Mitteleuropäischen Demokratien“, welches von der Moderatorin Prof. Dr. Ellen Bos mit einer Einführung in die Thematik eröffnet wurde. Der erste Vortragende Dr. András Hettyey, Junior Research Fellow der Andrássy Universität Budapest, referierte über den sinkenden Enthusiasmus gegenüber der Europäischen Union (EU) in den Visegrád-Staaten. Aufgrund der Eubarometer- Umfragen schilderte er vergleichend die Beurteilung der Mitgliedschaft, das Vertrauen in die EU, die Beurteilung der Erweiterungspolitik und die Erweiterungsmüdigkeit in den ausgewählten Ländern. Überall könne man von einer sinkenden Tendenz sprechen, so Hettyey, man müsse aber auf den Unterschied zwischen den alten und neuen Ländern der EU achten. Im Osten der Union sei das Vertrauen in die EU in den letzten Jahren in bedeutendem Maße gesunken, zugleich plädiere man aber für die Fortsetzung der Erweiterungspolitik. Ungarn zeichne sich durch einen hohen Grad von Skeptizismus aus, während es den Beitritt der Nachbarländer propagiere. Hettyey sprach von einer faktischen Beitrittspause bis 2020, die auf mehrere Gründe zurückgeführt werden könne. In dieser Hinsicht wies er auf die schlechten Erfahrungen der Vergangenheit, d.h., den Beitritten im Jahr 2004 und besonders 2007 hin. Der Referent sagte zusammenfassend, dass zurzeit mehr Pragmatismus als Enthusiasmus herrsche, was aber nicht zugleich das Ende der Erweiterungspolitik bedeute, und wies nochmals auf die unterschiedlichen Interessen im westlichen und östlichen Teil der Europäischen Union hin.
Dr. Kálmám Pócza, Junior Research Fellow der Andrássy Universität Budapest, sprach über den Zusammenhang zwischen Verfassungsgebung und politischer Kultur und berichtete von seinem aktuellen Forschungsprojekt, in dem er den Verfassungsgebungsprozess in Ungarn und England vergleicht. Die Grundlage dieses Vergleichs sei die analoge politische Situation in den zwei Ländern, in der dank der uneingeschränkten Macht der Regierung die Verfassung verändert werden kann. Pócza wies zugleich auf die Unterschiede hin: Ungarn etwa befand sich 2010 zwischen Transformation und einer etablierten Demokratie und die Regierung wählte während des Verfassungsgebungsprozesses eine konfrontative Politik. Pózca schlägt in seinem Projekt einen neuen Interpretationsansatz bezüglich des Verfassungsgebungsprozesses vor: Statt über eine „Putinisierung“ zu sprechen, sollte man ausgehend von den Theorien der Konsens- vs. Mehrheitsdemokratie bzw. des legalen vs. politischen Konstitutionalismus einen anderen narrativen Rahmen wählen. Er betonte mehrfach, dass der Verfassungsgebungsprozess in Ungarn im Rahmen des politischen Konstitutionalismus zu untersuchen sei.
In der anschließenden Diskussion erklärten sich mehrere Teilnehmer mit dem Ansatz von Pócza einverstanden und betonten im Zusammenhang mit dem Vortrag von Hettyey, dass die Erweiterungspolitik in den unterschiedlichen Ländern sehr divergierende Konnotationen hat, genauso wie der Begriff „Europa“.
Panel 6: „Postsozialismus und Extremismus“
Das sechste Panel „Postsozialismus und Extremismus“ wurde von PD Dr. Hendrik Hansen eingeleitet. Den ersten Vortrag hielt Prof. Dr. Patrick Moreau vom Centre Nationale de la Recherche Scientifique über die Fortdauer und Erneuerung der kommunistischen Bewegung und Ideologie. Die Präsentation begann mit einem Blick auf die 1980er Jahre und der zentralen Frage, wie man ein Modell des Kommunismus und Postsozialismus konstruieren könne. Moreau stellte eine europäische Typologie der kommunistischen Parteien auf: Das traditionalistische Modell baue auf grundlegenden klassische Ideologemen auf, wobei Parteien sich nach dem Prinzip des demokratischen Zentralismus richten und jedes Bündnis mit Sozialisten oder Sozialdemokraten ablehnen . Die neue Rechte sei in dieser Auffassung „der bewaffnete Arm der Kapitalisten“. Das rot- grüne Modell sei laut Moreau eine moderne Bürgerbewegung, die u.a. die Parolen der Ökologie, der Umverteilung des Reichtums, die Akzeptanz der Zuwanderung, den Feminismus, die direkte Demokratie, den Pazifismus und die kritische Opposition zur neoliberalen EU propagiert. Das dritte Modell sei reformorientiert und stelle einen Versuch dar, die geretteten Ideologeme den neuen Erwartungen anzupassen. Moreau charakterisierte dieses Modell durch Heterogenität, Akzeptanz von unterschiedlichen Strömungen, kleinen Apparate und einen hohen Grad an Professionalität. Zusammenfassend stellte der Referent fest, dass für alle drei Strömungen die angestrebte Hegemonie ein problematisches Verlangen sei und die nationalpolitischen Rechte ein Haupthindernis. Zuletzt könne man mit Ausnahme des rot-grünen Modells auch noch über einen Veralterungsprozess sprechen.
Prof. Dr. Attila Pók, stellvertretender Direktor des Instituts für Geschichte der ungarischen Akademie der Wissenschaften, sprach über den postsozialistischen Extremismus. Sein Ausgangspunkt war die Frage, wie die Extremisten in Europa einen so bedeutenden Einfluss erlangen konnten. Laut Pók sollte man die weichen Elemente des politischen Lebens analysieren, zwischen Radikalismus und Extremismus differenzieren bzw. der Frage nachgehen, inwieweit die Vergangenheit in den genannten Bewegungen nachwirke. Zuletzt sei auch die Dialektik zwischen Hass und Angst zu beachten. Pók listete weiterhin die Merkmale des Extremismus auf, sprach über dessen Erscheinungsgebiete und ging seinen Wurzeln bzw. Ursachen nach. Als Fallbeispiel fungierte Ungarn, dessen spezifische Eigenheiten mit Hilfe von Umfrageergebnissen veranschaulicht wurden. Der Vortrag ging in dieser Hinsicht auf die Unterschiede zwischen der MIÈP und JOBBIK ein, um hiernach auf mögliche Szenarien hinzuweisen, wie man mit solchen Bewegungen umgehen könne. In der Auffassung von Pók beinhaltet sowohl die Marginalisierung als auch der Versuch der Integration der Extremisten Gefahren. Eine eindeutige Antwort nach dem angemessenen Umgang mit ihnen werde erst die Politik und die Geschichte liefern können.
In der Diskussion stellte der Moderator die Frage, ob der Rechtsextremismus in der ungarischen Gesellschaft verankert sei. Pók bejahte und wies auf das schwarz-weiße Geschichtsbild der Ungarn hin. Weiterhin wurden die Unterschiede zwischen dem Extremismus im Osten und Westen Europas besprochen.
Podiumsdiskussion II: Die Bedeutung der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit für die Entwicklung der Demokratie
Den zweiten Teil der Konferenz schloss eine Podiumsdiskussion zum Thema „Bedeutung der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit für die Entwicklung der Demokratie“. Teilnehmer waren Prof. Dr. Andreas Oplatka, Professor a.D. der Andrássy Universität Budapest und der Budapester Historiker Dr. Krisztián Ungváry. Moderator PD Dr. Hendrik Hansen betonte in seiner Einleitung, dass die kommunistische Vergangenheit in Ungarn noch immer nicht genügend diskutiert sei, während die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit fester Bestandteil des deutschen politischen Verständnisses sei. Die zentrale Frage der Diskussion war, wie das Fehlen oder die Existenz der Auseinandersetzung mit der kommunistischen Vergangenheit die politische Kultur Ungarns präge.
Oplatka stellte einige Thesen aus der Perspektive eines Historikers bezüglich der kommunistischen Vergangenheit Ungarns auf. In seiner Interpretation habe das Land eine besondere kommunistische Geschichte, die von der Revolution 1956 geprägt wurde. Die Opfer der Revolution hätten den Umgang Moskaus mit der Budapester Politik stark beeinflusst und die viel erwähnte „Stabilisierung“ ermöglicht. Die Sprache der Gewalt sei eine, die in der Sowjetunion verstanden wurde. Da die Freiheit eine Summe von kleinen Freiheiten sei, könne man behaupten, dass es in Ungarn mehrere kleine Freiheiten gegeben habe. In der Wahrnehmung von Oplatka war János Kádár eine der rätselhaftesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts in Ungarn, der nach dem Prinzip „leben und leben lassen“ handelte. Als Gegenbeispiel brachte er die Tschechoslowakei. Dank der weichen Verhältnisse in Ungarn fanden statt einer Revolution Rundtischgespräche statt. Dieser Verhandlungsweg brachte mit sich, dass die politische Machtelite weiterhin aktiv bleiben konnte. Bezüglich der nationalistischen Pfeilkreuzler-Vergangenheit Ungarns und der kommunistischen Vergangenheit wies Oplatka auf den Historikerstreit hin und betonte, dass es für die Opfer einer Ideologie irrelevant sei, in welchem Namen sie ermordet wurden. Ungváry erklärte sich mit Oplatka grundsätzlich einverstanden. Er begann seine Erörterungen mit der Feststellung, dass für die Demokratie die politische Vergangenheit besonders wichtig sei, weil sie ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellen könne. Er stellte die These auf, dass die Strukturen der Machtausübung in Ungarn bis zum bitteren Ende dieselben geblieben und die Rundtischgespräche eine Farce gewesen seien. Die Reformkommunisten hätten begriffen, dass ihre einzige Chance eine Umstrukturierung sei. An diesem Punkt widersprach Ungváry seinem Gesprächspartner. Er wies darauf hin, dass nach 1989 die Frage beantwortet werden musste, wie man über die kommunistische Vergangenheit sprechen will. Die rechtskonservative Seite hatte wenig Spielraum eine derartige Auseinandersetzung zu beginnen. Das Bedürfnis, sich mit den kommunistischen Jahren kritisch zu beschäftigen, kam erst in den letzten Jahren auf. Die FIDESZ habe eine neue rechte Geschichtserklärung angeboten, nachdem sie erkannt habe, dass auf der rechten Seite des politischen Spektrums eine Lücke existiere, so Ungváry. Der Historiker betonte weiterhin die unaufgeklärte Rolle der katholischen Kirche im Kommunismus und identifizierte diese als Grund für die FIDESZ, das Thema nicht aufgreifen zu wollen. Abschließend kehrte er zu seiner ersten These zurück und unterstrich, dass das größte Problem der ungarischen Demokratie ihre Unglaubwürdigkeit sei und hierdurch die Geschichte zum Machtspiel der Politik verkomme.
Oplatka reflektierte den kurzen Vortrag von Ungváry und erklärte sich mit dem Gesagten grundsätzlich einverstanden, er unterstrich aber neben der Ähnlichkeit der kommunistischen Strukturen in Ungarn bzw. in anderen Ländern den unterschiedlichen Rahmen. Im Zusammenhang mit den Rundtischgesprächen könne man zwar über Manipulation sprechen, sie aber eine Farce zu nennen würde in der vertretenen Ansicht zu weit gehen. József Antall könne man einen Idealisten nennen, seine Absichten waren aber durchaus zu bejahen, denn ein Machtwechsel mit Prozessen wäre ein Teufelskreis gewesen, so Oplatka. Zuletzt zitierte er den Schrifsteller Fjodor Dostojewski, um den Mechanismus des ungarischen Kommunismus zu veranschaulichen: „Knechtet uns, aber macht uns satt“.
In der abschließenden regen Diskussion, bei der sich das anwesende zahlreiche Publikum aktiv beteiligte, wurden u.a. die Bewertung des Kommunismus in Ungarn und seine Aufarbeitung, die Prägung des Kádár-Regimes, die Rolle der katholischen Kirche, die Rolle der Parteien in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, der Zusammenhang zwischen Wahlentscheidungen und der Vergangenheitsbewältigung, das Haus des Terrors in Budapest zur Aufarbeitung diktatorischer Geschichte, die Pfeilkreuzler-Vergangenheit und schließlich auch die Täter- und Opferrolle debattiert.
Bericht von Dr. Enikő Dácz
Panel 7: „Zivilgesellschaft in westlichen und mitteleuropäischen Staaten im Vergleich“
Der dritte Konferenztag begann mit dem siebten Panel zum Thema „Zivilgesellschaft in westlichen und mitteleuropäischen Staaten im Vergleich“. Die erste Referentin Anna Katharina Bohl, Doktorandin der Universität Passau, forscht zu Ideen des amerikanischen Progressivismus und der Herausbildung des Wohlfahrtsstaates in Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie betrachtete die Entwicklungen der Zivilgesellschaft vor diesen theoretischen Kontext und betonte den Wert der Erfahrbarkeit von Demokratie für deren Herausbildung. Der Progressivismus entwickelte sich Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA und wurde zur Grundlage des amerikanischen Staatsverständnisses: Der Mensch trete als soziales Wesen in den Staat ein und leite aus der Gemeinschaft Besitz und Freiheit ab. Demokratie ist danach mehr als eine Regierungsform, die auf die Bürger wirkt. Sie basiert auf gemeinsamen Erfahrungen. Hiernach bedeutet Zivilgesellschaft mehr als ein gesellschaftlicher Einflussbereich auf Politik. Sie befindet sich im permanenten Kommunikationsprozess und in ihr bilden sich Erfahrungen der Menschen als Individuen und als Gemeinschaft heraus. Mit Blick auf die post-kommunistischen Länder stellte die Referentin abschließend fest, dass v.a. die Erfahrungen der Menschen als demokratische Individuen fehlen. Hierfür sollten neue Strukturen geschaffen werden, die neue Wege, aber auch eine Grundwerte-Debatte beinhalten.
Prof. Dr. Maté Szabó, ungarischer Ombudsmann, beschäftigt sich im zweiten Teil des Panels mit der Entwicklung der Zivilgesellschaft in Ungarn. Die Diskontinuitäten der Entwicklungen in Mittel- und Osteuropa seien essentiell beim Verständnis der heutigen Situation. Es fehlen soziales und wirtschaftliches Kapital zur Ausbildung breiter zivilgesellschaftlicher Strukturen, aber auch Artikulationsprobleme im Umgang mit der Vergangenheit, Institutionalisierung und Skepsis gegenüber Vereinen und Stiftungen seien bedeutsam. Die wiederholte Erfahrung der Fremdherrschaft und vor allem die Manipulation der Öffentlichkeit unter kommunistischer Herrschaft unterdrückten die Herausbildung der Zivilgesellschaft. Diese Öffentlichkeit (wieder)herzustellen, sei ein langer Prozess. Er ist während der „aufholenden Modernisierung“ in Mittel- und Osteuropa häufig neben wirtschaftlichen und strukturellen Aspekten zu wenig beachtet worden. Dennoch betonte der Referent, dass in Ungarn seit dem Jahre 1990 Fortschritte festzustellen seien. Doch aufgrund der fehlenden Erfahrung eines Normalzustandes fällt eine Bewertung schwer.
In der an den Vortrag anschließenden Diskussion wurde auf die vorhandene Protestkultur Ungarns, etwa auf 1956 oder den „Taxifahrer-Aufstand“, auf vorhandene Organisationsstrukturen und auch die Bedeutung der Gewaltlosigkeit der politischen Wende 1989/90 verwiesen. Diese Merkmale bilden das Fundament für die Entwicklung und Stärkung der Zivilgesellschaft in Ungarn.
Panel 8: „Political culture in Hungary/Politische Kultur in Ungarn“
Das abschließende achte Panel der Tagung stand unter dem Titel „Political culture in Hungary/Politische Kultur in Ungarn“. Eingangs wurde darauf hingewiesen, dass in Ungarn eine große Differenz zwischen „Staat“ und „Nation“ herrscht. Die Arrangements mit den fremden Herrschern in Ungarn begründen bis in die Gegenwart das tiefe Misstrauen in politische Institutionen.
Prof. Dr. Andràs Bozóki, Professor für Politische Wissenschaft an der Central European University, leitete seinen Vortrag mit einigen Schlaglichtern aus der Geschichte ein. Bedeutsam im Selbstverständnis Ungarns sei die Wahrnehmung als Sprachinsel sowie die Erfahrung der Jahrhunderte dauernden Fremdherrschaft. Letztere manifestierte die Einstellung der Bürger, außerhalb der formalen Institutionen zu agieren. Während der Staat für offizielle Strukturen mitunter fremder Interessen stand, entwickelte die Nation als patriotische Heimat große Bedeutung. Hieraus leitete der Referent auch anhaltende Zweifel und Zurückhaltung bei Prozessen der Europäisierung ab. Zudem ist bedeutsam, dass prägende Ereignisse der Geschichte des 20. Jahrhunderts, etwa der Vertrag von Trianon oder der Holocaust, nicht kritisch diskutiert und aufgearbeitet wurden. Dies seien einige der Aspekte, die dem Ausbau demokratischer Strukturen nicht förderlich waren. Zudem konnte ein Teil erforderlicher Reformen nach 1990 nicht bzw. nur ungenügend umgesetzt werden und die wirtschaftlichen Entwicklungen des Landes entsprachen nicht der Hoffnung der Bevölkerung. Die Enttäuschung ob des politischen Systems wuchs. Seit der Wirtschaftskrise 2008 nahm die negative Einstellung zu und kann als Grundelement des politischen Wandels Ungarns im Jahr 2010 verstanden werden.
Prof. Dr. Ferenc Miszlivetz von der ungarischen Akademie der Wissenschaften und der Westungarischen Universität betonte im Anschluss die Bedeutung der Auseinandersetzung mit politischer Kultur im wissenschaftlichen Kontext. Die Annahme, dass mit der Einsetzung demokratischer Strukturen und Institutionen auch eine politische bzw. öffentliche Kultur entsteht, wurde nicht erfüllt. Es müssen konzeptionelle Fragen in Betracht gezogen werden, die Fehler in demokratischen Systemen verbessern können. Zur Situationsbeschreibung Ungarns sei die fehlende Streitkultur, Verantwortung und Selbstreflexion (Katastrophen erfolgten unter Fremdherrschaft) und die anhaltende Ablehnung aller fremder Einflüsse staatlicher (EU, u.a.), aber auch gesellschaftlicher Seite (Fremde, Migranten, Minderheiten) bedeutsam. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit würde auch eine eigene Positionierung zur Vergangenheit erfordern. Dies sei in weiten Teilen ausgeblieben und hätte die Verhaftung in alten Strukturen befördert.
Das Donau-Institut für Interdisziplinäre Forschung und die Andrássy Gyula Universität betrachteten die aufgrund allgemeiner und gegenwärtiger Fragen so vielfältig ausgestaltete Tagung als Erfolg. Viele Bedrohungen und Krisen der Demokratie wurden angesprochen, bei denen die Politikwissenschaft gefragt ist, Konzepte und neue Ideen zu liefern.
Bericht von Katharina Haberkorn
Internationaler Doktorandenworkshop
Im Rahmen der Konferenz „Politische Kultur in der Demokratie – Herausforderungen für Politiker und Bürger“ fand am 10. Oktober ein internationaler Doktorandenworkshop zum selbigen Thema statt.
Organisiert und moderiert wurde der Workshop von Frau Prof. Dr. Ellen Bos, Leiterin des Donau- Instituts für Interdisziplinäre Forschung und der Doktorschule der AUB, PD Dr. Hendrik Hansen, Dekan der Fakultät für Vergleichende Staats- und Rechtswissenschaften der AUB sowie Dr. Zoltán Tibor Pállinger, Dekan der Fakultät für Internationale Beziehungen der AUB.
Der Workshop war eine thematische Fortführung des im Mai 2012 ebenfalls an der AUB durchgeführten Doktoranden-Workshops „Krise der Demokratie“. Das Thema ist angesichts anhaltender Politikverdrossenheit und schwindenden Vertrauens in politische Institutionen hoch aktuell.
Nach einer kurzen Begrüßung und Einleitung durch Frau Prof. Dr. Bos begann das Programm mit einem Vortrag von Tim Kraski, Doktorand der AUB, zu dem Thema „Was sind Bürgertugenden? Politische Kultur aus aristotelischer Sicht“. Herr Kraski legte dar, wie die Ideen der antiken Philosophie zur politischen Kultur dabei helfen können, die politische Kultur in modernen Demokratien zu verbessern. Dazu erläuterte er die drei Tugenden, die Aristoteles bei den Bürgern voraussetzt, um eine politische Kultur zu schaffen: Freigiebigkeit, Gerechtigkeit im Tausch und Mäßigung des Erwerbsstrebens. Nach Aristoteles schaffen sie die Grundlage für vernünftig handelnde Individuen und sorgen somit für ein harmonisches und stabiles politisches Umfeld.
Der Staat und seine politische Kultur sind demnach auf die Einstellungen der Bürger angewiesen. Herr Kraski schloss daraus auf eine Abhängigkeit der Tugendhaftigkeit von der Bildung. Er kam zu dem Schluss, dass die Herausforderung für Bürger und Politiker in modernen Demokratien darin besteht, eine Bildung bereitzustellen, die den Bürgern Reflexions- und Urteilsfähigkeit vermittelt.
Eine angeregte Diskussion folgte dem Vortrag. Offen blieb die Frage, inwieweit man aus den Lehren der Antike konkrete Maßnahmen ableiten kann, um die politische Kultur in modernen Demokratien zu verbessern.
Im Anschluss referierte Eva Odzuck, Doktorandin der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen- Nürnberg, zum Thema „Die Rolle der Politischen Theorie in der Politischen Kultur liberaler Demokratien“. Frau Odzuck stellte fest, dass die politische Kultur eine tragende Säule liberaler Demokratien ist. Für die Schaffung einer politischen Kultur sind wiederum politische Theorien wichtig. Unter politischer Kultur der liberalen Demokratie verstand die Referentin den Konsens über zentrale politische Ideen, wie beispielsweise die Freiheit und Gleichheit der Menschen. Dieser Konsens über die grundlegenden politischen Ideen in einem Staat ist eine wichtige Bedingung für das Funktionieren von Institutionen der liberalen Demokratie, auf den bei der Diskussion politischer Fragen und Entscheidungen zurückgegriffen werden kann. Daraus ergibt sich, dass die politische Kultur und letztendlich die Funktionsfähigkeit der liberalen Demokratien gefährdet werden, wenn ein solcher Kernbestand an geteilten Ideen nicht, noch nicht oder nicht mehr vorhanden ist. In diesem Fall müssen die bestehenden politischen Theorien weiterentwickelt, oder neue politische Ideen geschaffen werden, die die Grundlage einer politischen Kultur und somit eines politischen Diskurses darstellen können.
Es folgte ein Vortrag von Roxana Stoenescu, Doktorandin der Babeș-Bolyai Universität in Klausenburg, zum Thema „Der Wandel der Öffentlichkeit und ihre Auswirkung auf die heutige politische Kultur in der Demokratie“. Frau Stoenescu legte dar, dass die politische Öffentlichkeit auf ein Verbreitungsinstrument politischer und wirtschaftlicher Interessen privater Gruppen reduziert wurde. Die politische Öffentlichkeit entstand durch neue Arten der Kommunikation, vor allem der Erfindung der Schrift, die maßgeblich dazu beitrug, Privatleute in Form von Lesegesellschaften zusammenzubringen. Dadurch wurde das Private öffentlich und es fand eine kritische Auseinandersetzung mit öffentlichen Themen statt. Es bildete sich eine öffentliche Meinung, die eine politische Meinung wurde. Frau Stoenescu kritisierte, dass die heutigen Medien eine Massenproduktion darstellen. Sie zielen weniger darauf ab, die Bildung einer kritischen Meinung zu erzeugen, als private Interessen spezifischer Gruppen durchzusetzen. Ihr Fazit war, dass die Sinnentleerung der Kommunikation zu einer Auflösung der politischen Öffentlichkeit und damit zur Auflösung der Entwicklung der politischen Kultur führe.
In der auf den Vortrag folgenden Diskussion wurde kritisiert, dass in dieser Herangehensweise das Vorhandensein neuer Formen der Kommunikation außer Acht gelassen wird. Hingewiesen wurde etwa auf den maßgeblich über die Online-Medien Facebook und Twitter organisierten arabischen Frühling. Es ergab sich deshalb die Frage, ob es nicht eher zu einem Strukturwandel in der Bildung der öffentlichen Meinung, nicht aber zu deren Auflösung komme.
Das Programm wurde mit einem Referat von Raul Rognean, ebenso Doktorand der Babeș-Bolyai Universität, mit dem Titel „Wie viel institutionalisierte Religion verträgt die heutige politische Kultur? Fallbeispiel: Rumänien – die Orthodoxe Symphonia als Subjekt für Demokratiedefizit“ beendet. Er untersuchte die Beziehung zwischen Staat und orthodoxer Kirche in Rumänien und Griechenland. Dabei erachtete er die Einmischung der orthodoxen Kirche in die Politik als problematisch.
Er legte anhand zahlreicher Beispiele dar, dass die orthodoxe Kirche in Griechenland immer noch großen Einfluss auf die Politik hat. Beispielweise wird dem Bischof das Recht eingeräumt frei zu entscheiden, wie er mit weltlichen Behörden zusammen arbeitet. Herr Rognean wies darauf hin, dass die orthodoxe Kirche in Griechenland de facto eine Staatskirche sei. Sie hat Vorrangsrecht vor allen anderen Konfessionen. In Rumänien ist die orthodoxe Glaubensrichtung zwar keine Staatsreligion, aber ihr wurden einige Privilegien zugeschrieben: Sie muss keine Steuern zahlen und ihre Priester werden vom Staat finanziert. Herr Rognean kritisierte, dass die orthodoxe Kirche die Politik des Staates als Schauplatz für ihre eigenen Interessen benutze. Als Beispiel gab er den Amtseid des rumänischen Staatspräsidenten an, welcher vor der Kirche abgelegt werden muss. Die Einmischung wird auch daran sichtbar, dass viele Gesetze nicht verabschiedet werden können oder verändert werden müssen, damit sie mit den Prämissen der Kirche übereinstimmen.
Der Referent sprach sich am Ende seines Vortrags für eine stärkere Trennung von Staat und Religion in den orthodox geprägten Ländern aus. Die Anfangsfrage, wie viel institutionalisierte Religion verträgt die heutige politische Kultur verträgt, blieb offen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich alle Teilnehmer des Workshops einig waren, dass die politische Kultur in den modernen Demokratien verbessert werden muss. Dabei wurden interessante Ansätze zur Wiederherstellung der politischen Kultur vorgestellt, die von den Lehren der Antike über die Entwicklung neuer politischer Ideen, einer kritischen Auseinandersetzung mit den Medien bis zu einer stärkeren Trennung von Kirche und Staat gingen.
Bericht von Janina Apostolou
Die Konferenz wurde vom Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland, vom DAAD und vom Projekt TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0015 unterstützt.



 ETN
QuickLinks
Contact
ETN
QuickLinks
Contact
 Start Your Studies!
Scholarships
Degree Programmes
PH.D. Programme
Admission
Alumni Association
Start Your Studies!
Scholarships
Degree Programmes
PH.D. Programme
Admission
Alumni Association
 Subscribe to our newsletter
Subscribe to our newsletter